Fragst Du Dich auch manchmal, was mit den ganzen Wörtern passiert, die Du im Laufe des Tages nicht gesprochen oder geschrieben hast?
Ich stelle mir gerne vor, dass ich für manches ein tägliches oder wöchentliches Kontingent habe, z.B. für zwischenmenschliche Kontakte, für Lächeln, oder eben für Wörter. So wie das jährliche Budget für Straßenbau in meiner Heimatstadt. Im Herbst wurden an den unmöglichsten Stellen Verkehrsinseln und Bremsschwellen gebaut, um im nächsten Jahr nicht etwa weniger Geld aus dem großen Topf zugewiesen zu bekommen.
Wenn das persönliche Budget ausgeschöpft ist, dann hat man vielleicht schon um 15 Uhr kein Lächeln mehr übrig und ist schon vom Atmen eines anderen Menschen genervt, oder aber man hat noch was über, lächelt völlig unmotiviert Bremsschwellen und Verkehrsinseln in die Luft und wird in der Bahn weiträumig umgangen, hat als einziger noch einen Sitzplatz neben sich frei, weil Leute, die ohne erkennbaren Grund lächeln, unheimlich sind.
Übriggebliebene Wörter kann man vielleicht durch Selbstgespräche loswerden, oder durch sinnlose Blogbeiträge wie diesen, aber das ist ja doch beides nicht jedermanns Sache. Ich empfinde es schon als merkwürdig, mit den Katzen zu reden. Selbstgespräche kommen also für mich nicht in Frage. Zumindest jetzt noch nicht. In 30 bis 40 Jahren, wenn ich eine bösartige alte Frau geworden bin, so eine, vor der alle Kinder in der Straße Angst haben und bei der sie beim Martinisingen nicht klingeln, gehe ich vor mich hin brummelnd umher und habe niemals mehr Wörter übrig, wenn ich einschlafen will.
Es ist nämlich so, dessen bin ich mir sicher, dass man von diesen Übriggebliebenen am Ende des Tages heimgesucht wird. Drohend ballen sie sich in den Ecken des Kopfes zusammen und tuscheln. Dieses Tuscheln knapp über der Grenze, an der es gehört werden kann. Ein Crescendo von Zischlauten, harten Ts und Ps (mit Spucketröpfchen) und bedeutungsschwangeren drei Punkten. Und dann kann man nicht oder nur schlecht schlafen. Im Kopf setzt sich Staub ab. Du siehst, es ist alles sehr dramatisch.
Wochenenden und Urlaube können besonders gefährlich sein!
Mit drei Punkten wird es noch ernster:
Wochenenden und Urlaube können besonders gefährlich sein…
Denken heißt zerstören. Der Denkvorgang opfert den Gedanken, denn Denken heißt auseinandernehmen. Könnten die Menschen das Geheimnis des Lebens sinnend erfahren, könnten sie die tausend Verstrickungen erahnen, die der Seele bei der geringsten Regung drohen, sie würden nicht einen Finger rühren, geschweigedenn leben. Sie würden vor Schreck vergehen, wie all jene, die Selbstmord begehen, um nicht anderentags unter der Guillotine zu enden.
(Fernando Pessoa – Das Buch der Unruhe)
Dein Seufzen treibt eine Weile auf dem Wasser. Erste Sonnenstrahlen umhüllen es mit rosa-goldenem Licht, bevor es in den Wellen des Flusses versinkt.
Wir sitzen auf einem Steg am Leineufer. Ein paar Enten schwimmen vor dem Steg herum. Jede von ihnen trägt einen kleinen Trenchcoat mit hochgeschlagenem Kragen, eine Zigarre im Schnabelwinkel und hält in den Flügeln eine Zeitung mit diskreten Löchern zum Durchgucken.
„Ihre Beschattungstechnik ist nicht mehr sehr zeitgemäß“, flüstere ich verschwörerisch.
Du schaust mich verständnislos an und ich begreife, dass das stundenlange Gespräch in der endgültigen Trennung mündet, denn früher hättest Du verstanden und gelacht, jetzt siehst Du nur noch einige der allgegenwärtigen Enten.
„Es gilt, sehr schnell zu sein, bevor das Verständnis und der Wille zur Nachsicht in eine Schlammschlacht ausarten. Es ist der Trick, sich das vorher einzugestehen, die Idealvorstellung einer freundschaftlichen Trennung zu demaskieren und dem neugewonnenen Gegner einen Schritt voraus zu sein.“
So hätte es Macchiavelli in seiner Brigitte-Kolumne geschrieben.
Ich atme die aprikosenfarbene Luft ein und starre auf die verschwimmenden Buchstaben des Leibnitz-Zitats an der Mauer des historischen Museums. Mit zusammengekniffenen Augen kann ich gerade noch die Turmuhr der Marktkirche erkennen. Schon halb fünf.
Keiner von uns sagt etwas. Die Stille hat die Konsistenz einer der zähen Rindsrouladen, die meine Mutter früher auf den Tisch brachte, wenn die Familie gegen malayischen Linseneintopf mit Bananen oder Grünkernauflauf das Veto einlegte. Auf denen konnte man auch stundenlang rumkauen wie auf einem Kaugummi. War der Geschmack verbraucht, blieb der faserige, graubraune Klumpen zurück, den wir alle mit Todesverachtung schluckten. Ich frage mich, ob meine Mutter wirklich glaubte, uns würden die Rouladen schmecken.
„Jetzt, wo wir getrennte Leute sind, ist gegenseitiges Verständnis im Prinzip obsolet. Trotzdem möchte ich Dir eine Geschichte erzählen. Und zwar die von den Russen:
Als ich nach der Arbeit nach Hause komme, sitzen zwei Männer im Esszimmer. Einfach so. Mit der Selbstverständlichkeit von Familienmitgliedern. Beide haben Senfkristall vor sich stehen und eine große Flasche Wodka. Der eine ist bestimmt schon Anfang 50, sein Gesicht sieht aus wie von einem geschickten Künstler in rotem Lehm modelliert, etwas blasser, aber im gleichen Farbton. Selbst die Falten und Kerben haben etwas Mineralisches an sich, sogar sein Haar, wie das einer billigen Perücke, passt farblich ganz Ton in Ton zum Rest. Jemand sollte ihm mal sagen, dass Ton in Ton out ist. Die hellblauen Augen schwimmen in wässriger Gleichgültigkeit. Gleichzeitig ist er eine einzige Forderung, immerzu bereit, aufzuspringen und die ihm zugedachten Gaben des Lebens an sich zu reißen.
Der andere macht einen eher empfindsamen Eindruck, mit feineren Gesichtszügen, feinem schwarzen Haar und Augen, die man nur als seelenvoll bezeichnen kann. Ich stelle ihn mir sofort mit pomadisiertem Haar, in Frack und blankgeputzten Lackschuhen in einem Rauchzimmer vor, auf dem Tischchen neben ihm ein Kristallglas mit Likör. Mit feinen Herrschaften philosophische und soziale Probleme der Jahrhundertwende diskutierend. Albern, was einem während der Sekunden des ersten Ansehens durch den Kopf schießt. Mein Vater ist im ganzen Haus nicht zu finden und ich bin unsicher, was ich mit diesen beiden Männern anfangen soll.
Ich rufe Gerda an. Das Gespräch mit ihr ist eine Art Tauziehen mit Gummiseilen, aber immerhin weiß ich danach, dass die beiden Herren Juri und Michail heißen, zwei Deutschrussen und Musiker sind, die nun bei uns wohnen. Im Zimmer neben meinem. Sie seien wertvolle Künstler im Stil verfolgter Dissidenten. Nahezu Kleinodien.
Ich versuche, mich über diese Bereicherung zu freuen und gehe zurück um mich zumindest vorzustellen. Danach will ich eigentlich nur Ruhe. Stattdessen bekomme ich ein Glas Wodka aufgenötigt und Zigaretten angeboten.
Nach einem gefühlten Liter Schnaps kommt die Gleichgültigkeit. Juris Hand auf meinem Bein ist mir egal. Juris Hand an meinen Brüsten ist mir egal. Wäre ich nüchtern, täte ich aus Anstand etwas geziert, wäre aber trotzdem gleichgültig. Mein Körper ist etwas, das eben an mir und meinen Gedanken dranhängt. Stecken kaum Empfindungen drin. Im Laufe des Abends haben sich die beiden wohl geeinigt, denn Juri schleppt mich ganz selbstverständlich in mein Bett, zieht mich aus und fasst mich an. Kein Streicheln, eher ein lustloses Reiben, als müsse das eben sein, bevor man weitermachen kann. Wäre ich nüchtern, ich täte so, als gefiele mir das. Stöhnte etwas, bewegte das Becken, wie ich das sonst tat, wenn ich mit jemandem mitging. Jetzt liege ich aber einfach da. Er zieht erst meine Hosen runter, dann seine eigenen. Keinen Ton gibt er von sich, als er vehement in mich eindringt, nicht mal ein Ächzen oder Grunzen. Als bringe er eine Pflichtübung hinter sich. Sein Körpergeruch überwältigt meinen eigenen Dunst in einer resignierten feindlichen Übernahme. Es dauert überraschend lange, bis er seinen Prügel aus mir herauszieht und sich, immer noch geräuschlos, anzieht und das Zimmer verlässt. Auf dem Max Ernst Druck an der Wand neben mir entdecke ich Details, die mir bisher verborgen gewesen waren, obwohl der weiße Schleier des Moskitonetzes darüber liegt. Die Wolke links oben im Bild sieht fast aus wie ein Pandagesicht. Ein Comicpanda. Ich mag Max Ernst lieber als H.R. Giger. Die Bilder sind auf eine weniger plakative Art düster und beklemmend. Wenn man will, kann man eine Ahnung von Hoffnung daraus zusammensuchen, muss aber nicht.
Sperma läuft aus mir heraus, es fühlt sich an, als mache ich ins Bett. Irgendwie ist es auch genauso. Ich mache stellvertretend für den Mineralischen in mein Bett. Besudle es. Die große Eule schaut mir wohlwollend mit plüschig umrahmten Glasaugen dabei zu.
Ich krieche durch die Löcher in der grünen Höhle, das Licht draußen verliert sich, die Pandawolke ist jetzt ein Rochen, oder eine Schlange. Sobald man in dem Bild drin ist, kann man sie nicht mehr sehen, doch die Wolken müssen sich verändern und weiterziehen, denn mit mir in der Szene muss zwangsläufig Zeit vergehen, Dynamik entstehen.
Das Moos, das die Höhleneingänge weich aufpolstert und den Boden zu einer ersten Ruhestätte macht, drücke ich mit Knien und Händen platt. Wo ich länger verharre, richtet es sich nicht wieder auf und an anderen Stellen kann ich hören, wie es aufatmet, weil meine Last fort ist. Ich bin schon so weit in den Berg vorgedrungen, dass das Klopfen und Öffnen meiner Zimmertür kaum noch zu hören ist. Jemand setzt sich neben mich auf die Bettkante. Der Boden aus weichem Gestein knarrt leise und gibt unter dem zusätzlichen Gewicht nach. Eine Feder streicht über mein Haar und die Wangen. Sie scheinen ganz feucht zu sein. Das Dunkel verkrampft sich, etwas nähert sich. Etwas Süßliches, Dumpfes. Zwei weiche Kissen legen sich auf meine Stirn, die Feder streicht über meinen Bauch. Ich ziehe die Beine an und drehe den Kopf und den Rest von mir weg, wieder dem Bild und der Wand zu. Die Höhle hat mich in das faulige Bett ausgespuckt. Gänsehaut dringt auch dort hin, wo mich noch das eine Hosenbein bedeckt. Mehr geht nicht, nur wegdrehen mit letzter Kraft. Die Feder löst sich nicht mit einem Puff in Luft auf, vielmehr bohrt sie sich penetrant sanft hinein. Nicht in den Körper, sondern in mich. Es ist angenehm und abstoßend gleichzeitig, wie Obst kurz vor dem Verfaulen. Wie an Stefanies Geburtstag auf dem Schoß ihres Stiefvaters. Michail gibt fortwährend Schhhs von sich, wie ein Zug. Er soll aus mir verschwinden. Niemand darf in mich hinein.“
Die Frau starrt blicklos in meine Richtung. Ihre Augen wogen selbstständig auf und ab mit den Wellen des Flusswassers. Vorhin hat sie mich noch angesehen, als hätte sie mich erkannt und es war dieser Blick, der mich bewog, den beiden eine der kostbaren, unendlichen Minuten für ihre Trennung zu schenken. Jetzt ist ihre Präsenz ein Loch in der Luft. Der Mann legt den Arm um sie und ich schwimme mit den anderen Enten am Ufer entlang auf eine alte Dame zu, die Brotstücke ins Wasser wirft. Auf dem Uhrenturm der Marktkirche schubst ein spielzeuggroßer Mensch den Zeiger an.
Teil I – Die Menschen
Hannover Südstadt.
01.10.2014
Julia schloss die Tür zu ihrer Wohnung auf und hatte nur noch einen einzigen Gedanken. Im Verlauf der U‑Bahnfahrt nach Hause hatte er sich zunehmend verfestigt und die Vorstellung wurde immer realer, war schon fast so wärmend und tröstend wie die Realität es sein würde.
Julia dachte an ein heißes Bad. Ein schaumiges, wohliges Bad mit einem Glas Prosecco am Wannenrand und einem Hörbuch. Die ganze Anspannung des Tages würde von ihr ablassen. Der starke Griff, den die Sorge um ihre Patienten immer häufiger fest um ihren Nacken drücken ließ, würde mit dem Wasser einfach den Abfluss runterrauschen.
Julia ließ den neuen, roten Mantel von ihren Schultern gleiten und sah sich einen Moment lang im Spiegel neben ihrer Garderobe in die Augen und in das müde dreinblickende Gesicht.
Ihre Freundinnen behaupteten, es sei ein Barbie-Gesicht. Mit feinen Gesichtszügen, hohen, aber nicht zu harten Wangenknochen, kornblumenblauen Augen, einer zierlichen Nase und einem kleinen, runden Mund. Das ganze Kunstwerk wurde umrahmt von vollem, blonden Haar. Sie selbst fand, jedem müsste genau wie ihr die schiefe Nasenscheidewand auffallen, als weise eine Leuchtreklame darauf hin. Die Haut, die im Sommer nie brauner als ein goldener Honig wurde, war nicht makellos. Außerdem war sie zwar langbeinig und groß, immerhin fast 1,80, aber einfach zu mollig.
Barbie! Dass sie nicht lachte!
Sie ging ins Badezimmer und drehte den Wasserhahn ihrer Wanne auf, goss etwas Badeschaum dazu und ging dann in die Küche, um sich ein Glas wohlverdienten Feierabendprosecco einzuschenken.
Gerade, als sie den ersten köstlichen Schluck nehmen wollte, hörte sie ein Rascheln, das aus dem Wohnzimmer zu kommen schien. Julia ging mit einem mulmigen Gefühl hinüber. Die Feierabendentspannung verschwand augenblicklich.
Im Wohnzimmer war jedoch nichts zu sehen.
Dann bewegte sich ein Blatt der großen Yuccapalme in der Ecke am Fenster. Das Ding war zwar so riesig, dass es fast bis zur Decke reichte, aber nicht groß genug, um einem Einbrecher Schutz vor Entdeckung zu bieten. Komisch, dachte Julia.
Dann entdeckte sie den kleinen Spalt an der Tür zum Balkon. Offenbar hatte sie diese am Morgen nicht richtig geschlossen.
Beruhigt ging Julia mit dem Prosecco, den sie schon völlig vergessen hatte, hinaus und zündete sich eine Zigarette an. Jetzt würde auf Teufel komm raus entspannt werden!
Sie inhalierte tief und stieß dann mit einem undamenhaften Grunzen den Rauch wieder aus. Mit jedem Zug verschwanden die alten Leute, die wegen Diabetes und Einsamkeit das Wartezimmer der Gemeinschaftspraxis bevölkerten, im Dampf. Mit jedem Zug stieß sie die Besorgnis über das magersüchtige junge Mädchen aus. Sie alle bekämen keinen Quadratzentimeter Platz in ihrem Heim. Diese Schutzmaßnahme war notwendig, das wusste sie.
Zum Baden würde sie einen harmlosen Liebesroman hören und sich mit rosaroter Zuckerwatte umhüllen.
Die Wanne war jetzt voll und sie drehte den Wasserhahn zu. Schaum ragte in großen Bergen in die Höhe und es knisterte wunderbar, als sie ins Wasser stieg und sich hineinaalte. Durch die offene Badezimmertür erzählte das Hörbuch, wie eine junge Bürokauffrau den ersten Blick auf den Mann warf, der die Liebe ihres Lebens sein musste. Ja, sein musste.
Julia schloss die Augen.
Ein Rascheln. Sie schrak hoch. Da war es schon wieder. Dabei hatte sie die Balkontür fest verschlossen!
Dieses Mal kam es aus dem Flur.
Sie kniff die Lider fest zusammen und öffnete sie wieder. Sie sah in die dunklen Knopfaugen einer Ente.
Erneut schloss sie kräftig die Augen und schüttelte den Kopf. Das war doch unmöglich.
Augen wieder auf. Die Ente war noch da und schaute sie an. Ganz gelassen, so schien es. Ihre paddelnden Füße verursachten Strömungen im Badewasser.
Ich muss sie berühren, um sicherzugehen, dass das Vieh keine Einbildung ist, dachte Julia. So stressig war der Praxisalltag nun auch wieder nicht.
Gemächlich, um das Tier nicht zu verschrecken, streckte sie den Zeigefinger aus und strich über den linken Flügel. Er fühlte sich zugleich glatt und etwas rau an.
Die Ente schrak nicht zusammen, schlug nicht panisch mit den Flügeln auf und ab, sondern sah sie nur stoisch an. Dann wackelte sie mit dem Bürzel.
Julia konnte sich gerade noch ein entzücktes Quietschen verkneifen.
Hannover List
01.10.2014
Er war erschöpft. Mehr als erschöpft. Er war eigentlich nur zu erledigt, um tot umzufallen. Für diese 36 Stunden-Dienste wurde er langsam zu alt.
Sven wusste schon jetzt, dass er am ersten der beiden freien Tage nichts von seiner To-do-Liste schaffen und es dann Ärger mit ihm selbst geben würde. Es wäre klüger, sich nicht mehr so viel… Nein. Er würde es nie lernen. Diese und andere unclevere Eigenarten waren schon untrennbar mit seinem Charakter verschmolzen.
Er schloss seine kleine Einzimmerwohnung auf, ließ seinen Rucksack auf den Boden fallen und stapfte in den schweren Stiefeln in die Küche.
Die Lache vor der Waschmaschine war inzwischen komplett von dem Berg Schmutzwäsche aufgesaugt worden. Scheiße.
Er würde den Geräteservice sofort anrufen. Vielleicht hatte er Glück und es käme schon morgen jemand.
Sven holte sich ein Bier aus dem Kühlschrank, nahm das Telefon von der Station und rief die Hotline an.
Es raschelte ganz leise aus der Waschmaschine. Er zuckte zusammen. Genau in diesem Moment verstummte die Warteschleifenmusik, wich einem Klacken in der Leitung und eine Frau, deren professionelle Freundlichkeit etwas gequält klang, meldete sich. Einen Moment lang wusste Sven nicht genau, was er jetzt tun sollte und sagte nichts. Wieder dieses leise Rascheln. Kaputte Waschmaschinen laufen aus, aber sie raschelten nicht. Was war das?
Mit dem Hörer in der Hand näherte er sich dem offenen Bullauge des Geräts. Die Tür stand noch genauso offen, wie er sie gestern zurückgelassen hatte.
„Hallo! Sind Sie noch dran?“ tönte es aus dem Telefon. Sven konnte noch immer nicht antworten. Er war zu verblüfft.
„Hallo! Sie! Wenn Sie sich nicht melden, kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen und muss zum nächsten Kunden umschalten. Hallo?!“
Aus dem Dunkel der Waschmaschinentrommel lunzte eine Ente und sah Sven direkt an. Sie, nein er, es war ein Erpel, schwamm in dem nicht abgepumpten Wasser. Seine Knopfaugen blickten ihn ruhig und gelassen an. Das Tier schien keine Angst zu haben, dafür war jedoch Sven kurz davor, in seiner kleinen Küche in Ohnmacht zu fallen.
Der Erpel wackelte aufmunternd mit dem Bürzel. Fast so, als wolle er sagen: „Nimm es nicht so schwer, Kumpel. Wir alle kennen solche Tage.“
Sven ließ sich auf den Boden plumpsen und starrte in das Gesicht der Ente. Sie gab keinen Laut von sich. Sven ächzte und legte das Telefon zur Seite. Aus dem Hörer klang noch das Freizeichen, aber das nahm er gar nicht wahr. In der anderen Hand hielt er noch die Bierflasche fest umklammert. Er nahm einen großen Schluck, schüttelte den Kopf und guckte noch einmal in die Waschmaschine hinein. Da schwamm der Erpel und schaute ihn unverändert gelassen an.
Noch ein großer Schluck. Noch ein Kopfschütteln. Erneuter Blick, dieses Mal von der Seite. Der Erpel drehte den Kopf in seine Richtung und sah ihm tief in die Augen.
Sven streckte vorsichtig die Hand aus und tippte sachte nach einem der Flügel. Der fühlte sich überraschend rau an. Überhaupt, er fühlte sich an. Das bedeutete, er hatte tatsächlich eine lebendige Ente in seiner Waschmaschine und jetzt wusste er auch nicht weiter.
Für derartige Vorkommnisse gab es keinen Leitfaden, kein standardisiertes Vorgehen aus einem Handbuch. Das einzige, was ihm gerade zu tun einfiel, war, sein Bier aufzutrinken. Eventuell könnte er noch ein zweites trinken.
Was er dann auch tat.
Eine groteske Situation war das. Sven fühlte sich hilflos angesichts dieser Ente. Dabei war es doch nur eine Ente! Ein Vogel. Er könnte diesen Vogel einfach nehmen und nach draußen bringen. Dann würde er noch einmal 15 kostbare Minuten seiner Freizeit in der Warteschleife eines Callcenters verplempern, um einen Termin für das defekte Gerät vereinbaren. Problem gelöst, Wochenende gerettet.
Wie war das Tier überhaupt in seine Wohnung hineingekommen? Dass es in der Waschmaschine saß, konnte er noch nachvollziehen, schließlich stand Wasser drin. Aber sonst. Nein. Es wäre ja auch nicht so, als mache dieser, zugegeben recht hübsche Erpel auch nur Anstalten, aus der beengten Waschtrommel wieder raus zu wollen.
Und das er selbst nicht schon längst etwas getan hatte, um Abhilfe zu schaffen, war auch mehr als eigenartig. Grotesk, ein Begriff, den er bisher eher mit Tarantino Filmen verbunden hatte, war das einzige Wort, fand Sven, welches das alles passend beschrieb.
Er prostete der Ente zu. Die Ente bürzelte.
Sven war entzückt. Noch ein Bürzeln. Sven quiekte.
Es sah fast so aus, als sei der Erpel zufrieden.
Hannover Linden – Enercity Gebäude
01.10.2014
Ralf sah aus dem großen Fenster im Büro des Abteilungsleiters für Netzerweiterung auf die Ihme. Es war ein sehr hübsches Büro, nicht nur wegen des Ausblicks und weil es groß war. Der junge Hinrichs hatte es auch geschafft, den Raum sowohl gemütlich, als auch funktionell einzurichten. Ein vielseitiger Mann. Sein Vater, der alte Hinrichs, der im Vorstand des Unternehmens saß, hatte es dem Sohn auf dem Weg in die Führungsetage nicht leicht gemacht. Ralf war trotzdem ein wenig neidisch. Ein bisschen Neid ist erlaubt, entschied er. Seine Eltern waren keine einflussreichen Leute gewesen und so war er selbst zwar fleißig, aber dennoch nur ein Elektriker. Ein Elektriker, der im schicken Büro eines immer mächtiger werdenden Mannes Hilfsarbeiten verrichtete.
Draußen bewegten sich Jogger und Radfahrer, Familien mit Kindern und Hunden am Wasser entlang. Die Sonne schien auf sie alle herab, die sie da glücklich einen der letzten wärmeren Tage des Frühherbstes genossen.
Eine Oma samt Enkel, er vermutete mal, dass es Oma und Enkel waren, stand am Ufer des Kanals und fütterte eine Horde Enten. Ihre Brotstücke flogen weit auf die Mitte des Wassers hinaus. Der pummlige Arm des kleinen Jungens beförderte das begehrte Backwerk gerade mal bis auf die Steine zwischen Wasser und Wiese.
Die Enten stürzten sich aufgeregt auf jeden neuen Brocken Futter. Er konnte das Schnattern beinahe hören. Leider drang davon kein Laut bis in das oberste Stockwerk des Enercity Gebäudes. Selbst den Verkehrslärm hörte man hier oben nicht.
Ralf stellte sich vor, wie es wäre, hier zu arbeiten. Umgeben nur von Stille. Das Leben außerhalb der Wände wäre zum Schweigen verdonnert, zur Bedeutungslosigkeit.
Im obersten Stock wäre man Gott. Durch Öffnen und Schließen der Fenster durfte das Leben sein oder eben nicht sein, drinnen herrschte der Inhaber des Büros, und es wäre auch kein Büro mehr, sondern eine Schaltzentrale der Macht.
Wer hier saß, thronte, herrschte bereits über die Stromversorgung der Region.
„Ohne Strom sind wir alle nicht mehr weit entfernt vom Chaos“ dachte Ralf philosophisch.
Sein Meister während der Lehrzeit war manchmal von solch schwergewichtigen Gedanken befallen worden und ließ jeden, der nicht schnell genug fortkommen konnte, daran teilhaben. Das meiste war zum einen Ohr rein und zum anderen wieder rausgegangen aber es blieb hängen, dass Elektrizität Wohltat und Gefahr zugleich war und äußerste Sorgfalt im Umgang mit ihr lebenswichtig.
Er wandte sich der kaputten Steckdosenleiste zu. Die Sicherungen und anderen dazugehörigen Abnehmer hatte er schon überprüft. Alle waren in Ordnung, nur diese eine nicht, was eigentlich unmöglich war. Unterwegs konnte kein Strom einfach so verloren gehen, oder im Sande verlaufen. Am liebsten würde er den Boden aufreißen. Nur eine Überbrückung zwischen Hauptleitung und der Steckdose konnte das Problem verursachen. Er hatte alles abgesucht und nichts gefunden. Für alles, was er noch tun könnte um die Störung zu finden musste er zuerst Rücksprache halten. Außer ihm war keiner mehr im Haus. Hatten schon Wochenende.
Für ihn war es jetzt auch Zeit.
Zeit, beim Rewe auf der anderen Seite des Kanals etwas Brot zu holen und die Enten zu füttern. Niemand legte schließlich fest, dass Entenfüttern nur für Kinder sei. Und es wartete auch niemand mehr sehnsüchtig auf ihn. Olga hatte ihn letzte Woche verlassen. War einem in seinen Augen windigen Fotografen aufgesessen.
„Er findet mich schön! Und er sagt es mir auch! Nicht wie Du! Du bist wie ein Stein!“ Ihren melodramatischen Abgang krönte sie mit Türknallen und wütendem Klackern ihrer schwindelerregend hohen Schuhe. Zurück blieb eine erstickend aufdringliche Wolke von Parfum, diverser Kosmetika und dem billigen Weichspüler. Seine Trauer um ihren Fortgang wurde von dieser Kakophonie der Gerüche sofort im Keim erstickt.
Ralf schrieb Hinrichs eine Notiz und sich selbst eine Erinnerung, rechtzeitig vor Wochenbeginn eine Mail bezüglich der notwendigen Maßnahmen zu schreiben. So was machte einen guten Eindruck.
Dann packte er sein Werkzeug zusammen und nahm die Treppen statt des Fahrstuhls.
Ein leichtes Flattern durchströmte ihn und ein Tatendrang, den er schon lange nicht mehr gespürt hatte.
Er war frei. Wenn er wollte, konnte er nach dem Entenfüttern einen Döner holen, im Pub Bier trinken und die Nacht zum Tag machen. Den Döner mit vielen Zwiebeln und Knoblauch. Keine Vorhaltungen. Absolute Freiheit.
Aber das Bett wäre auch noch leer, wenn der Döner dann schwer im Magen lag.
„Idiot!“ schalt er sich selbst.
„Geht´s jetzt endlich auch ins Wochenende Herr Möller?“
Der Pförtner Herr Masowski war hollywoodreif ältlich und väterlich wohlwollend. Er kannte fast alle Mitarbeiter mit Namen. Sein Kollege von der Nachtschicht war noch jung, von der Wichtigkeit seiner Aufgabe so durchdrungen, dass es ihm eng wurde zwischen Beinen und Armen. Der saß nicht am Empfang, sondern stand breitbeinig daneben, oder patrouillierte geschmeidig wie eine mit Steroiden vollgepumpte Marionette durch die Etage. Also er waren eigentlich viele. Fast jede Nacht ein anderer. Sie sahen aber alle gleich aus, also waren sie einer.
„Ja. Gleich gehe ich die Enten an der Ihme füttern. Hab ich ewig nicht mehr gemacht.“
Der alte Herr Masowski lachte. „Meine Renate und ich, wir sind früher ganz oft Enten füttern gewesen. Vielleicht, wenn das Wetter morgen noch mal so schön ist, wie heute…“ Er lachte wieder. „Und danach setzen wir uns romantisch auf eine Bank und hängen unseren Erinnerungen nach.“ Ein Zwinkern.
„So sei es!“ verkündete Ralf theatralisch, wedelte mit den Armen und entschwand dramatisch durch die sich öffnenden Türen in den Lärm der Stadt.
HAZ vom 24.10.2014
Der OB der Stadt Hannover, Stefan Schostok, hat ein neues Familienmitglied adoptiert.
„Edwin saß eines Tages ganz unerwartet in unserem Zimmerbrunnen. Offensichtlich mochte er uns. Die Zuneigung beruht natürlich auf Gegenseitigkeit. Nun haben wir ihm offiziell ein Heim im Gartenteich angeboten. Nach harten Verhandlungen bewohnt er jetzt auch ein großes Kissen im Wohnzimmer. Dem treuherzigen Blick und dem Wackeln eines Entenbürzels hätte nicht einmal die Opposition widerstehen können.“
Wir freuen uns auf eine Homestory mit Edwin, Herr Oberbürgermeister!
HAZ vom 30.10.2014
Wir berichteten vor einer Woche über den Erpel Edwin Schostok. Die Familie des Oberbürgermeisters hat diesbezüglich ihren Exklusivitätsstatus verloren. Immer mehr Einwohner der Region Hannover berichten von tierischem Besuch, u.a. der Landesvorsitzende der CDU Niedersachsen, David McAllister.
Welcher Fügung die Stadt dieses neue Miteinander von Ente und Mensch zu verdanken hat, lässt Ornithologen rätseln und, dank Twitter und Co., Menschen in den entlegensten Winkeln der Welt gespannt teilhaben.
Eine Ente in der Straßenbahn ist kein ungewohnter Anblick mehr für Hannoveraner.
„Noch muss für eine Ente kein Ticket gelöst werden, aber wir arbeiten bereits daran.“ So Pressesprecherin der Üstra, Britta Kielmann, mit einem verschmitzten Lachen.
Auch die Deutsche Bahn muss sich inzwischen mit dieser neuen Situation auseinandersetzen. Immer mehr Reisende aus Hannover möchten ihre Ente nicht allein zu Hause lassen.
Nicht nur in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die friedliche Invasion der „Wasservögel von nebenan“ ein wichtiges Thema geworden.
„In die Bibliothek dürfen keine Haustiere hineingebracht werden. Das gilt nicht nur für Hunde sondern auch für jedes andere Tier.“ Suleika Azman war in der vergangenen Woche mehrfach gezwungen gewesen, die glücklichen Entenpartner, die nicht ohne den neuen Mitbewohner Bücher ausleihen wollten, der Bibliothek zu verweisen. Dies verlief in einzelnen Fällen nicht ganz gewaltfrei.
Vor Lebensmittelgeschäften und Kinos, Bars und Arztpraxen wurden ähnliche Szenen beobachtet. „Nicht ohne meine Ente!“
Hannover Linden
02.11.2014
Ralf sah auf. Die Stimme fuhr ihm durch Mark und Bein. Vorsichtig und, wie er hoffte, unauffällig sah er sich um.
Olga hatte mit ihrem neuen Lover den Pub betreten. Ihm ging in diesem Moment auf, dass er sie doch vermisste. Es war kein innerer Schmerz, der ihm das mitteilte, sondern die Tatsache, dass sein Schwanz sich verhärtet hatte wie Granit und er gleichzeitig nur seinen Kopf in ihren Schoß betten wollte, um sich von ihr den Kopf streicheln zu lassen.
Olga hatte das oft getan, wenn sie der Meinung war, er sei aufgewühlt. Das wiederum hatte sie immer vor ihm wahrgenommen.
Während sie dann mit leichten Händen ruhig und gleichmäßig über sein dunkles, dichtes Haar strich und gurrend vor sich hin plapperte, war es, als bräche der Stress in ihm auf und verteilte sich in der Luft wie Gas.
Jetzt also wollte er das. Die ganzen letzten Wochen hatte er das gewollt. Das und ihre schlanken Beine um seine Hüften.
Erschüttert von der Erkenntnis nahm er einen großen Schluck Cuba libre.
Manni stupste ihn verständnisinnig mit dem Schnabel am Ellenbogen.
Ralf sah in die dunklen Knopfaugen seines neuen Freundes und fühlte sich sofort besser.
Seine Kumpel und Arbeitskollegen waren Ralf seit der Trennung und seit diesem einen Tag im Büro des jungen Hinrichs immer fremder geworden. Anfangs hatten sie noch versucht, ihm Aussagen der Trauer oder auch Wut zu entlocken, waren aber gekränkt, weil er ihnen das mit Olga nicht sofort erzählt hatte. Sie schoben es auf seinen Stolz, dann auf mangelnde Freundschaft, dann fragten sie nicht mehr und die Themen der weniger werdenden Treffen wandten sich wieder dem aktuellen Tagesgeschehen zu.
Ralf fand es sowieso viel spannender.
In fast jedem Haushalt wohnte inzwischen eine Ente freundschaftlich mit den Menschen zusammen. Das war einfach so umwälzend spannend!
In seinem Fitnessclub, in dem keine Hunde erlaubt waren, saßen Enten fröhlich schnatternd neben den Crosstrainern und Gewichtbänken, während ihre Menschen schwitzten und trainierten.
Ja, es wirkte ein bisschen so, als seien die Menschen die Haustiere der Enten, genau wie bei Katzen.
Diese Parallele zwischen den Fressfeinden amüsierte Ralf.
„Was meinst Du“, fragte er seinen Erpel, „sollte ich zu Olga rüber gehen und Hallo sagen? Ganz lässig und über den Dingen?“
Manni schüttelte energisch den Kopf und schaute etwas mitleidig.
„Du hast Recht. Soll sie doch kommen.“
Manni stupste ihn erneut an.
„Wollen wir aufbrechen? Was essen und den Rest des Abends auf dem Sofa sitzen wie die zwei Junggesellen, die wir sind?“
Manni nickte ernst.
„Homeland gucken?“
Manni nickte wieder. Es sah aus, als grinste er.
„Carrie ist scharf. Irre, aber scharf.“
Der Erpel bürzelte.
Als sie zur Theke gingen, um zu bezahlen, sah Olga demonstrativ in eine andere Richtung und legte besonders fröhlich lachend den Kopf in den Nacken.
„So gut, wie sie tut, geht es ihr nicht“, stellte Ralf befriedigt fest. „Ich kenne sie gut genug, um das sofort zu erkennen.“
Er sah zu Manni hinunter, der aber nur zielstrebig in Richtung Wohnung zur Ampel watschelte und keinen Blick für Gehässigkeiten übrig hatte.
„Herr Möller!“
Ralf erschrak. Auch Manni zuckte zusammen.
Er drehte sich um und sah eine große blonde Frau auf sich zu laufen. Sehr hübsch, das musste er sagen. Sie lächelte ihn keuchend an. Eine Ente drückte sich schüchtern an ihr Schienbein.
Als sie ihm die Hand entgegenstreckte, wusste er auch wieder, wer sie war: Seine Hausärztin, Frau Dr. Thielemann. Ohne den weißen Kittel sah sie ganz fremd aus.
„Immer wieder komisch, die Leute außerhalb ihrer natürlichen Umgebung zu sehen“, dachte Ralf.
„Frau Dr. Thielemann. Wie geht es Ihnen?“
„Das ist eigentlich mein Text“, sagte sie und lächelte noch strahlender.
„Es geht mir gut. Danke. Eben war ich im Bronco´s mit Natalie.“ Sie nickte in Richtung der Ente, die sich bereits angeregt mit Manni zu unterhalten schien.
„Da gibt es die besten Mojitos, finde ich. Ach, und sagen Sie doch Julia.“
„Freut mich, Julia. Ich heiße Ralf.“
Sie schüttelten sich erneut, diesmal etwas verlegen, die Hände. Dann waren sie beide sprachlos.
„Die beiden verstehen sich ja schon sehr gut, wie es aussieht“, lachte Julia.
„Es sieht ganz so aus“, sagte Ralf und ärgerte sich sofort über diese lahme Erwiderung.
Julia fiel das gar nicht auf. Sie war zu sehr damit beschäftigt, Ralf nicht anzustarren.
Ihre Freundinnen würden natürlich unumwunden lästern, vielleicht etwas verrucht lachen und sie daran erinnern, dass ein Elektriker höchstens fürs Bett in Ordnung war. Kein Grund, sich ins Spitzenhöschen zu machen.
Gerade jetzt wurde ihr bewusst, wie lange sie sich schon nicht mehr mit den Mädels getroffen hatte. Seit dem Studium hatten sie sich einmal in der Woche gesehen, oder zumindest telefoniert. Jetzt, da Natalie bei ihr „eingezogen“ war, hatten sie sich nicht mehr gesehen oder ausgetauscht.
In diesem Moment sah sie hinunter, direkt in die dunklen, freundlichen Entenaugen, und vergaß die vernachlässigten Freundinnen sofort wieder.
Eben entfernten sich die beiden Enten von ihnen.
„Wollen die uns etwas Privatsphäre gönnen, oder selbst unter sich sein?“
Ralf kicherte.
„Sogar, wenn er kichert, ist er sexy!“ Julia überlegte, was sie jetzt sagen könnte. Etwas Schlagfertiges. Aber nicht zu sehr, das wirkte meist abschreckend.
„Natalie ist sonst eher zurückhaltend. Das spricht wohl für diesen Erpel. Na ja, ich eigentlich auch.“
„Das spricht dann wohl für mich!“
Sie lachten.
Teil II – Die Enten
Hannover Linden – Ihme-Ufer unter der Benno-Ohnsorg-Brücke
02.11.2014
„Ruhe! Seid still und hört zu!“ Der bullig wirkende Erpel reckte den Kopf in die Höhe und begann drohend die Flügel zu öffnen.
„Schwimm etwas von mir weg, wir müssen Platz für Otto schaffen“, zischte Hanno seinem Kollegen Erik zu. Erik war ebenso bullig und kräftig wie Hanno selbst und tat sofort, was von ihm erwartet wurde. Heute Abend war es besonders wichtig, dass ihr Anführer Otto die angemessene Bühne für seine Rede bekam. Der Plan ging nun in die zweite Phase über, die Herde brauchte jetzt klare Anweisungen und straffe Führung, damit nichts schiefging.
Sie drängten die aufgeregt schnatternde Schar zurück und schufen zwischen Ufer und Wartenden einen freien Platz auf dem Wasser. Dann watschelte Otto an den Wasserrand und glitt in die Mitte des mühsam gehaltenen Freiraums.
Ihr Feldherr, wie er sich gern selbst bezeichnete, machte sich groß, zeigte einen Moment lang die ganze Spannbreite seiner perfekten Flügel, und erhob machtvoll seine volltönende Stimme.
„Freunde!“ rief er. „Mitstreiter und Mitenten!“
Die Menge verstummte.
Am Geländer der Brücke stand ein Pärchen Menschen und wunderte sich darüber, dass die ins Wasser geworfenen Brot- und Kuchenstücke von den vielen Enten unbeachtet zum Grund des Kanals sanken.
„Enten!“ Otto streckte erneut die Flügel und warf sich in die Brust.
Einige weibliche Enten in der ersten Reihe bekamen glänzende Augen bei dieser Demonstration des Herrschaftsanspruchs und bürzelten hingebungsvoll.
„Die Welt schaut auf uns! Wir haben uns den Menschen angenähert, zugelassen, dass sie sich in uns und unsere Art verlieben. Wir haben sie verführt und voneinander gelöst! Das ist großartig! Eine Leistung und gleichzeitig der Beweis, wie überlegen wir diesen angeblichen Herrschern der Erde sind!“
Begeistertes Schnattern und Johlen erhob sich in die Luft.
„Ihr. Seid. Großartig.“ Otto betonte jedes Wort.
Wieder Jubel.
„Eure Zielobjekte wollen und können nicht mehr ohne euch sein. Ihr habt Zugang zu allen Bereichen ihres Lebens bekommen. Das war harte Arbeit und hat euch zum Teil ein erhebliches Maß an Selbstverleugnung abverlangt, aber ihr habt es geschafft. Für unsere Sache!“
Otto ließ den Blick über die Versammlung gleiten und stellte zufrieden fest, wie viel Zustimmung ihm entgegen flog. Er konnte keine Querulanten erkennen. Wäre Widerstand erkennbar gewesen, hätten sich die Mitglieder seiner persönlichen Leibgarde sofort darum gekümmert. Alles lief bestens. Die Menge hing an seinem Schnabel.
Einige Nachzügler schwammen heran und fügten sich geräuschlos in die erwartungsvolle Stille.
„Wir haben den ersten Schritt getan. Die erste Phase unseres Plans ist ein voller Erfolg!“
Otto machte eine bedeutungsschwangere Pause, um dem Jubel und der Freude Raum zu geben. Er schaute nach links und rechts zu den treuen und loyalen Anführern seiner Leibgarde. Auch Hanno und Erik wirkten ergriffen vom Zauber seiner Worte.
„Die Zeit ist jetzt reif, um die zweite Phase unseres Plans einzuläuten! Phase zwei wird noch heute Nacht beginnen! Alle habt ihr eure besonderen Instruktionen bekommen.“
Otto erhob donnernd die Stimme.
„Seid! Ihr! Bereit?“
„Ja!“ schrien alle. „Ja! Wir sind bereit!“
„Seid! Ihr! Entschlossen. Und. Bereit?“
„Wir sind entschlossen und bereit!“ Die Enten verloren sich in einem Taumel der Euphorie. „Ja! Ja! Jaaa!“
„DANN WERDEN WIR DEN KAMPF BEGINNEN!“
Die Enten rasteten aus. Ottos Leibgarde versuchte gar nicht erst, Ruhe in die Versammlung zu bringen. Man musste ihnen die Freude und den Wahn lassen.
Otto hatte ihnen vor diesem Abend den Ablauf genau erklärt. „Die Euphorie brauchen sie. Das stärkt ihren Willen. Wir brauchen diesen Willen. Ohne die Kraft und den Willen der einfachen Enten können wir nicht gewinnen.“
„WIR WERDEN GEWINNEN!“ Ottos Stimme überschlug sich.
Die geballten Emotionen dieser Nacht steckten auch ihn an. Wochenlang unterdrückte Anspannung und der Verzicht brachen sich nun Bahn. Viele von ihnen hatten in der letzten Zeit ohne ihre Partner auskommen müssen. Aber niemand hatte gemurrt. Otto hatte entschieden, dass paarweise auftauchende Enten Misstrauen hervorrufen und ein Gefühl der Bedrohung auslösen könnte. Keiner hatte die Weisheit seiner Entscheidung angezweifelt. Man vertraute ihm, vertraute auf seine Klugheit und Intelligenz. Sein Führungsanspruch war absolut und unangefochten.
Er hatte Opfer gebracht. Jahrelange Isolation war notwendig gewesen, um sich all das Wissen anzueignen, das unabdingbar war zur Führung aller Enten. Wissen war Macht. Und diese Macht würde er nun ausspielen, um die Weltherrschaft an sich zu reißen.
Er dachte an die vielen einsamen Nächte in zahlreichen Bibliotheken. Horte des Wissens, die für ihn nur zugänglich waren, wenn die Menschen schliefen oder verbotenen Heimlichkeiten im Schutze der Dunkelheit nachgingen. Verstohlen und immer auf der Hut. Genau wie er selbst.
So hatte er auch seinen Namen gefunden, oder sein Name ihn. Otto. Nach dem ersten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Dieser Otto hatte die Menschen vereint. Er hatte seinen Einflussbereich vergrößert und eine Einheit geschaffen, die bis dahin auf diesem Wege unerreicht war. Ein großer Mann, der ihm, dem Erpel Otto, ebenbürtig war, wie er befand. Und der Name war einfach und eingängig.
Während alle anderen Enten umeinander balzten, sich fanden und Familien gründeten, Jahr um Jahr ihre Gelege durch die Kindheit in eigene Familiengründung hievten und begleiteten, hatte er aufgepasst und gelernt. Otto hatte früh erkannt, wie sehr diese ubiquitären, um- unter- und übereinander wimmelndenden Parasiten, die sich Mensch nannten und die Ideale erschufen und im gleichen Atemzug vergaßen, der Welt schadeten. Sie höhlten alles auf der Suche nach einem Mehr vollkommen aus. Auf der Jagd nach Besitztum überwarfen sie sich miteinander, überrollten und zerstörten sich. Nach logischen Gesichtspunkten hätte das genügen müssen, um sich selbst vom Antlitz der Erde zu tilgen, aber es ging zum Einen nicht schnell genug, und zum Anderen, was das Schlimmste war, rissen sie auch jedes andere Lebewesen auf diesem Planeten mit in den Abgrund.
Sie begannen sogar, ihr unersättliches Streben auf andere Planeten auszuweiten. Otto wurde klar, dass sie aufgehalten werden mussten. Von ihm. Auf ihm lastete die große Verantwortung der Aufgabe, ihnen Einhalt zu gebieten. Und er sollte verdammt sein, wenn er sie nicht erfüllen würde.
Doch jetzt, wo sein Plan aufging und die Spannung von ihm wich, traf ihn die Einsamkeit mit voller Wucht.
Dort hinten trieb Eva.
„Mein Evchen“, dachte er.
Die junge, auffallend schöne Ente war umzingelt von halbstarken Erpeln, die sich gegenseitig in Demonstrationen ihrer Männlichkeit zu übertrumpfen suchten. Eva versuchte sich spielerisch von ihnen zu entfernen. Ihr goldenes Gefieder strahlte über die Wasseroberfläche.
Otto war nicht mehr so jung wie ihre Verehrer, aber er war immerhin ihr Anführer. Er besaß Macht über alle Enten. Wenn das keine Demonstration von Männlichkeit war, wusste er auch nicht. Die Art, wie sie sich den Erpeln immer wieder entzog, ließ ihn hoffen.
Später, bevor er zurückkehrte in das Heim des Oberbürgermeisters, würde er Hanno nach Eva schicken.
Natalie und Manni schnäbelten zärtlich miteinander. Sie konnten es kaum fassen. So ein Glück, dass ihre Menschen zueinander gefunden hatten. Ein unglaublicher Zufall, oder hatte Otto das in seiner schier unendlichen Weisheit etwa gewusst und geplant?
Es war ihnen egal. Sie hatten sich so viel zu berichten. Und sie hatten einander so sehr vermisst. Es war das erste Mal gewesen, dass sie länger als eine Futtersuche für die Küken voneinander getrennt waren. Eine schreckliche Zeit, die sie nur mit dem großen Ziel im Auge überstanden hatten.
Aus Julias Schlafzimmer drangen immer lauter werdende Schreie, und so mussten auch sie nicht leise und heimlich sein. Kurz, sehr kurz, bedauerten sie andere Paare, die nicht so viel Glück bei der Auswahl der ihnen zugeteilten Menschen hatten. Dann wendeten sie sich wieder ihrem eigenen Glück zu.
Ralf und Julia hatten es in ihrer Turtelei gar nicht bemerkt, als Natalie und Manni leise die Wohnung verließen, um an der Generalversammlung teilnehmen zu können.
Die beiden Enten waren noch erfüllt von der unglaublichen Energie des Abends. Vorfreude und ein Schauder der Aufregung erfüllten sie.
Dass ihre beiden Menschen jetzt zusammen waren, machte ihre Aufgabe, die zwei zu überwältigen und einzusperren, gleichzeitig einfacher, weil sie ja selbst zu zweit waren, aber auch schwieriger, denn vereint würden sich Julia und Ralf nicht so schnell einschüchtern lassen.
„Am besten warten wir, bis sie wieder zusammen im Bett beim Kuscheln sind. Wusstest Du“, kicherte Manni, „dass die Menschen es auch ‚Vögeln‘ nennen?“
„Was?!“ kreischte Natalie. Sie fasste sich wieder. „Gute Idee, dann sind sie gar nicht in der Lage, schnell zu reagieren.“
„Wir könnten sie einfach einschließen. Müssen nur den Schlafzimmerschlüssel umgedreht kriegen.“
„Du bist ja witzig. Der steckt nicht mal im Schloss.“
„Dann“, überlegte Manni, „müssen wir sie irgendwie dazu bringen, sich selbst einzuschließen.“
„Das ist einfach“, sagte Natalie. „Sobald sie wieder vögeln wollen“, sie kicherte albern, „nerven wir sie so lange, bis sie abschließen.“
„Und dann? Die Tür kann dann jederzeit wieder von innen geöffnet werden, aber wir können nicht mehr rein und müssen Wache halten bis zum Ende unserer Tage!“
Manni schnaubte. „Wir brauchen eine andere Lösung.“
Hannover – Zooviertel
02.11.2014
Stefan Schostok war auf dem Weg zu seinem Arbeitszimmer. Es war schon spät, aber es war noch so viel zu tun. Er seufzte. Die Kinder hatten ihn aufgehalten. Edwin war verschwunden und er hatte mit ihnen zusammen nach dem abgängigen Erpel gesucht. Leider ohne Erfolg.
„Er ist, das haben wir alle vergessen, noch immer ein Wildtier. Vielleicht hatte er genug von uns. Oder er braucht einfach mal eine Nacht für sich, in einem schönen Teich.“
Die Kinder waren nicht zu trösten gewesen und er hatte ein Machtwort sprechen müssen, damit sie zu Bett gingen.
In der Politik war so etwas einfacher als zuhause.
Er öffnete die Tür zum Arbeitszimmer. Ein Lichtschein kam ihm entgegen.
Dann sah er Edwin auf dem Schreibtisch vor dem Computer sitzen.
„Da bist Du ja, Du Entenvieh! Wir haben Dich überall gesucht!“
Stefan Schostok ging um den Tisch herum und ließ sich in den Schreibtischsessel fallen.
„Die Kinder waren völlig krank vor Sorge.“ Edwin sah ihn neutral an. „Und ich auch“, fügte er hinzu.
Der Schnabel des Erpels sauste auf die Tastatur nieder. Erst jetzt sah der Bürgermeister, dass der Rechner eingeschaltet und Word geöffnet war.
‚Wenn Du um Hilfe rufst, hacke ich Dir mit dem Schnabel die Augen aus‘, stand dort.
„Edwin, was…“
‚Du und die Stadt befinden sich ab sofort in der Gewalt der Enten‘, hackte Edwin.
„Aber Edwin…“, versuchte Stefan Schostok es erneut.
Der Erpel hackte wieder mit dem Schnabel auf die Tastatur ein.
‚Außerdem heiße ich nicht Edwin. Mein Name ist Otto‘, las er.
Er wollte aufstehen. Irgendetwas machen. Das war doch völlig grotesk!
Da flog ihm der Erpel ins Gesicht. Die Federn strichen über seine Haut und er nahm den Geruch des Vogels, seine Wärme wahr. Es fühlte sich merkwürdig an.
Er hatte Edwin, nein, Otto schon zuvor berührt, aber da war die Initiative von ihm ausgegangen. Das hier war etwas anderes.
Sicher, den Kindern hatte er gesagt, Edwin… Nein, er musste sich schon wieder verbessern. Das Mistvieh nannte sich ja selbst Otto.
Also Otto sei ein Wildtier, hatte er den Kindern gesagt, dabei aber nur gedacht, der Erpel sei unter ein Auto geraten, oder von einem eifrigen Jäger geschossen worden. Er hatte keineswegs an so etwas gedacht.
Und der verdammte Vogel konnte einen Computer bedienen!
Er sank in den Sessel zurück.
‚Schön brav bleiben.‘
„Okay. Ich bleibe einfach hier sitzen und tue nichts. Okay?“
‚Ja.‘
Otto sah ihm fest ins Gesicht. Seine Entenaugen starrten feindlich und kalt.
Jetzt bürzelte das Vieh auch noch. Stefan Schostok meinte, darin Häme wahrzunehmen. Das könnte natürlich Einbildung oder Übertragung sein. Konnte eine Ente hämisch bürzeln? Nein. Bestimmt nicht.
Andererseits hätte er bis vor fünf Minuten auch jeden in die Klapsmühle schicken wollen, der behauptete, Enten könnten mithilfe von Word irgendjemandem drohen.
‚Otto, nach Otto I., dem Kaiser des hl. röm. Reiches deutscher Nation.‘ Otto quakte zufrieden. Der Mann im Sessel starrte ihn völlig entgeistert an.
‚Also. Folgendes…‘
Stefan Schostok, Oberbürgermeister der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover, passte jetzt sehr genau auf.
Der Morgen danach
Hannover Mitte – U‑Bahnstation Kröpcke
03.11.2014
Seit die Enten in die Heime der Menschen eingezogen waren, war bereits Ruhe in die Stadt eingekehrt. Nachts und in den frühen Morgenstunden waren, im Gegensatz zu Zeiten davor, kaum noch Nachtschwärmer unterwegs. Aber an diesem frühen Morgen war gar keiner unterwegs. In einem Western würden Büschel von Präriegras umher rollen.
Julia und Ralf trauten dieser Ruhe jedoch nicht und zuckten bei jedem Geräusch zusammen. Interessanterweise machte die zentrale U‑Bahnstation auch Geräusche, wenn sie völlig leer war.
Keine Menschenseele, und auch keine Ente war zu sehen. Nicht mal die allgegenwärtigen Tauben.
Sie hatten beschlossen, es sei am besten, sich unterirdisch zu verstecken und fortzubewegen.
In den Wohngebieten patrouillierten Enten durch die Straßen. Julia fragte sich, ob die diensthabenden Vögel ihre Menschen so, wie Natalie und Manni das bei ihnen getan hatten, zusammengelegt hatten, um keinen Menschen ohne entische Wache lassen zu müssen. Wollten sie andere befreien, war das eine wichtige Information.
Vielleicht schliefen noch einige und hatten noch gar nicht bemerkt, was in dieser Nacht passiert war.
Zuerst hatten sie überhaupt nicht verstanden, was los war. Ralf hatte ins Bad gewollt und die Tür hatte sich nicht öffnen lassen. Irgendwann im Laufe dieser unglaublichen Nacht begannen die Enten, immer wieder ins Schlafzimmer zu stürmen. Sie hüpften aufs Bett, drängten sich an sie und waren nicht zum Verlassen des Zimmers zu bewegen.
Eifersucht, hatten sie gedacht und schweren Herzens beide Vögel gepackt und ins Wohnzimmer verfrachtet. Dann waren sie zurückgeflitzt und hatten die Tür von innen abgeschlossen. Kurz machte sich ein schlechtes Gewissen bemerkbar, aber beide vergaßen das schnell.
Und dann bekamen sie die Tür nicht mehr auf. Kaugummi im Schloss.
Im Flur hörten sie die Enten schnattern, als führten diese ein angeregtes Gespräch. Nach einer Weile wurde die Wohnungstür geöffnet, das Geraschel von Flügeln, und sie waren allein.
Ralf hatte das Schlafzimmerfenster einschlagen müssen, und sie flohen ohne Zögern über den Balkon aus dem Haus. Der Weg zum Kröpcke war eine nervliche Zerreißprobe gewesen, beinahe wären sie einer Entenpatrouille in die Hände geraten.
Sie hatten an der Archivstraße kurz Halt gemacht und konnten beobachten, wie zwei Enten neben einer Frau herliefen. Julia und Ralf versteckten sich hinter einem großen Rhododendron. Zuerst schien es, die Enten gehörten zu ihr, denn sie watschelten niedlich wie immer, doch die Frau beachtete die Enten kaum. Eine von ihnen sprintete voraus, was besonders putzig aussah, und bürzelte heftig. Die Frau ignorierte es. Beide Enten stoppten kurz und sahen sich an. Dann flogen sie auf, landeten kurz vor der Frau erneut und bürzelten nun beide. Die Frau blickte stur geradeaus. Eine der Enten bürzelte unaufhörlich weiter und watschelte dabei ständig zwischen den Füßen der Frau hindurch, blickte fragend nach oben, bis diese der Ente einen kleinen Tritt versetzte. Diese flatterte ein wenig mit den Flügeln, bis sie sich gefangen hatte, und begann dann wie wild zu quaken. Im Nu war die Frau von ungefähr einem Dutzend weiterer Enten umgeben. Einige setzten sich auf ihre Schultern, eine sogar auf ihren Kopf. Die Frau versuchte sie mit den Armen zu verscheuchen, da begannen die Enten auf sie einzuhacken. Julia sah erschreckt, wie eine der Enten wie wild ihren Schnabel in das linke Auge der Frau rammte, bis ein ploppendes Geräusch ertönte. Die Vögel erstarrten. Aufgeregt ließen sie von ihrem Opfer ab und umkreisten sie mehrmals, einige schlugen konfus die Flügel auf und ab. Julia kam es so vor, als seien die Tiere von ihrer eigenen Tat überwältigt. Im nächsten Moment lag die kläglich Wimmernde allein auf der Straße. Julia erhob sich, um der Frau zu helfen, doch Ralf nahm ihre Hand und hielt sie zurück.
„Sie können jederzeit zurückkommen“, sagte er eindringlich. „Wir müssen sofort hier weg!“
„Aber…“
„Nein! Sofort! Du hast doch gesehen, was gerade passiert ist.“
Nachdem sie sich vergewissert hatten, dass sie allein waren, verließen sie ihre Deckung und rannten, so schnell sie konnten.
Nun waren sie angekommen und konnten endlich aufatmen, die Situation begreifen. Das alles war so völlig fernab ihrer Vorstellungskraft.
Plötzlich gingen alle Lichter aus. Es war mit einem Mal stockdunkel. Ralf zerrte sein Handy aus der Jeanstasche und entsperrte es. Das Leuchten des Displays schuf eine grausige Atmosphäre.
„Kein Netz“, sagte er langsam. „Sie müssen überall den Strom abgestellt haben.“
„Sie haben was?!“, rief Julia. „Es sind doch Enten!“
„Enten“, erwiderte Ralf, „die uns eingesperrt haben. Enten, die dabei ganz offensichtlich planvoll vorgegangen sind.“
„Ich kann noch gar nicht glauben, dass meine Natalie das getan haben soll. Sie ist doch so lieb und anhänglich.“ Sie schniefte leise. Im Tunnel wurde das Geräusch laut und hallte ihr von den Wänden des Schachts entgegen.
„Es hat sich tatsächlich keiner gefragt, wie es zu dieser Annäherung der Enten an uns kam. Wir waren alle so verzückt von ihren Knopfaugen über den Schnäbeln, dem Bürzeln… Keiner ist misstrauisch geworden.“
„Und jetzt ist es zu spät.“
„Ja, jetzt ist es anscheinend zu spät.“ Ralf straffte die Schultern. „Also gut. Wir müssen die Situation und unsere Möglichkeiten zusammenfassen und überlegen, was wir tun wollen.“
„Wir können keinen anrufen. Und wir können auch nicht durch die Tunnel aus der Stadt entkommen, denn die Bahnen fahren alle irgendwann oberirdisch weiter. Und wir haben beide kein Auto.“
„Das sieht doch ganz gut aus. Wir haben reichlich Möglichkeiten“, witzelte Ralf.
„Lustig!“
Entmutigt ließen sie sich auf die Schienen sinken.
Hannover, auf jedem Fernsehbildschirm
09.11.2014
Neben Stefan Schostok, auf dem Rednerpult, thronte Otto und sah ernst in die Kamera.
„Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich spreche heute an diesem bedeutsamen Tag zu Ihnen, um die veränderte Situation in der Stadt zu erklären.
Neben jedem von Ihnen sitzt eine Ente, von der Sie, und da gebe ich Ihnen mein Ehrenwort, ich wiederhole, mein Ehrenwort, nichts zu befürchten haben.“ Mit einem schnellen Seitenblick konnte er erkennen, dass Otto ihn ansah.
„Die Enten werden auch weiterhin unsere Freunde sein. Sie haben nichts als unser Wohl im Sinn. Zwar werden Sie sicherlich festgestellt haben, dass viele Bereiche des öffentlichen Lebens von Enten übernommen worden sind, doch dies geschieht zu unserem eigenen Schutz. Enten an den Universitätsfakultäten, bei den Stadtwerken, im Polizeidienst und der Stadtverwaltung bemühen sich nach Kräften die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten und sollen Sie keinesfalls verunsichern.
Wahrscheinlich haben Sie in den letzten Wochen ebenso wie ich eingesehen, dass das bisherige Machtgefälle zwischen Menschen und Enten uns keinerlei Frieden gebracht hat. Vielmehr befindet sich unsere Gesellschaft in einem desolaten Zustand, den wir als Verursacher kaum noch wahrgenommen haben. Wir Menschen sind immer mehr zu Parasiten verkommen. Die Enten werden uns helfen, diesem Teufelskreis zu entfliehen und ein neuer Mensch zu werden. Das bedeutet aber auch, dass wir die Weisheit unserer neuen Führer anerkennen und uns ihr bedingungslos unterwerfen müssen.
Es ist in unserem eigenen Interesse, den Enten Gehorsam zu leisten und keinen Widerspruch aus unseren Reihen zu dulden. Sehen Sie die Enten als das, was sie sind: Uns überlegen.“
Stefan Schostok war ein Medienprofi, dem es gelang, während dieser Rede seine eigenen Gefühle nicht nach außen dringen zu lassen. Er fuhr fort.
„Unsere glorreichen Führer halten in den Bürgerbüros für jeden Hannoveraner einen persönlichen Passierschein bereit, der zur kostenlosen Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb der Stadt sowie der Bibliotheken und Museen berechtigt. Diese wurden von jeder Art Glorifizierung der parasitären menschlichen Kultur bereinigt. Halten Sie Ihren Passierschein jederzeit bereit und zeigen Sie ihn bei jeder Entenpatrouille unaufgefordert vor. Zuwiderhandlung wird zu Ihrem eigenen Besten streng geahndet. Sehen Sie diese Maßnahmen als eine Hilfe, die wir danken annehmen, und ein Licht, das uns den Weg zur Wahrheit weist.
Und nun möchte ich Ihnen voller Stolz den großen Geist vorstellen, der uns in eine bessere Zukunft führen wird.“ Stefan Schostok klatschte in die Hände, verbeugte sich leicht und wies auf ihn: Otto.
Der Erpel reckte den Hals, warf sich in die Brust, öffnete leicht die Flügel, und nickte bedächtig. Dann entspannte er sich wieder und bürzelte.
Die Enten vor den Empfangsgeräten tobten und jubelten frenetisch, die Menschen neben ihnen starrten betreten ins Leere.
Hannover List
09.11.2014
Sven hatte die Rede von Stefan Schostok gemeinsam mit seinem Erpel Christoph gebannt verfolgt. Christoph hüpfte auf dem Sofa auf und ab und schlug mit den Flügeln. Zwischendurch erzitterte sein Bürzel. Sven betrachtete das Schauspiel und konnte in der Freude des Erpels nichts Böses erkennen. Sie hatten sich vor der angekündigten Rede ein Bier geteilt und Sven hegte den Verdacht, der noch nicht so trinkfeste Christoph sei schon besoffen. Eine Welle unendlicher Zuneigung durchflutete ihn. Der Erpel strahlte ihn an. In diesem Moment erkannte Sven, was er schon seit einiger Zeit geahnt hatte: ‚Ich muss pissen!‘
„Ich muss mal weg“, sagte er zu Christoph.
Christoph beäugte ihn misstrauisch und wirkte mit einem Mal gar nicht mehr betrunken. ‚Wohin?‘ schienen seine Augen zu fragen.
„Bier wegbringen. Soll ich deins mitnehmen?“
Der Erpel gab ein Geräusch von sich, das wie ein Lachen klang. Dann schüttelte er den Kopf.
Als Sven aus dem Badezimmer kam, begegnete ihm eine Ente mit Kochschürze. Sie blieb stehen. Auf ihrer Schürze stand: „Küss mich, ich bin der Koch“. Sven glotzte verdattert. Die Ente starrte ihn keck an, bürzelte kurz und watschelte dann in die Küche. Sven folgte ihr. In seiner kleinen Küche wühlte ein Erpel in der Besteckschublade. Auch er trug eine Kochschürze und drehte sich fragend zu Sven um. Auf seiner Schürze stand: „Geht eine Ente in eine Bar…“. Christoph streckte seinen Kopf aus der Waschmaschine und nickte ihm aufmunternd zu, fast so als wolle er sagen: „Hey, Kumpel, ich habe da mal ein paar Leute für ein ungezwungenes Sit-In eingeladen. Das ist doch okay für dich, oder?“
Sven fühlte sich überfordert und schüttelte sich. Obwohl die Enten ihn freundlich anschauten, fühlte er sich bedroht. Er warf schnelle Blicke in die anderen Zimmer, aber dort war niemand. Kurzentschlossen warf er die Küchentür zu, schnappte sich Jacke und Dienstrucksack und rannte aus der Wohnung, aus dem Haus. Von oben, aus der Wohnung, hörte er ein lautes Klopfen, als die Enten mit ihren Schnäbeln gegen das Küchenfenster hackten. Christophs enttäuschter Blick verfolgte ihn.
Hannover Linden
09.11.2014
Sven wusste nicht so recht, wie er es bis hierhin geschafft hatte, aber jetzt stand er vor einem der verwaisten Ladenlokale des Ihme-Zentrums. Erst jetzt bemerkte er, dass er völlig außer Atem war. Er sah nach oben. Dort brannte ein Licht. Ohne genaue Vorstellung, was ihn dort erwarten würde, stieg er die Außentreppen hinauf. Nicht ein einziges Mal schaute er sich um, sondern stiefelte Stufe um Stufe aufwärts. Daher wusste er auch nicht genau, auf welchem Stockwerk er sich gerade befand, als er die ekstatischen Rufe mehrerer Enten vernahm. Sie kamen aus der Wohnung direkt an der Treppe. Kurz fragte er sich, ob sie ihn gehört hatten. Er blieb stehen und lauschte von Sekunde zu Sekunde entsetzter dem, was da zu ihm aus der Wohnung drang. Die Worte klangen unbeholfen, wie ein Kind, das gerade seine ersten Schritte tat, doch er war sich sicher, es waren die Enten. Sie konnten sprechen. Also doch.
Aus dem Dunkel des Flures kam ein leises „Psst!“
Erschrocken wandte er sich um. Ein Paar am auf ihn zu. Man konnte ihnen ansehen, dass sie schon seit mehreren Tagen unterwegs gewesen sein mussten.
„Das ist Otto“, sagte die Frau. „Er schwört seine Leibgarde auf sich ein. Wir erklären dir alles, wenn wir oben sind. Hier können wir nicht bleiben.“
Sie packte Svens Hand. Gemeinsam rannten sie weiter die Treppen hinauf.
„In die oberste Wohnung kommen sie nicht hinein, frag mich nicht, wieso. Ich bin übrigens Ralf“, rief ihm der Mann über die Schulter hinweg zu.
Beide legten ein ordentliches Tempo vor und Sven wurde langsam die Schwere seines Rucksacks bewusst. Warum hatte er ihn überhaupt mitgenommen?
Hinter sich hörten sie Flügelschlagen und lautes Quaken.
„Da sind sie“, rief die Frau. „Wir müssen noch schneller laufen!“
„Es sind nur noch drei Stockwerke“, rief nun Ralf. Seine Stimme überschlug sich beinahe vor Aufregung und Panik. „Wir haben es fast geschafft!“
Sie rannten. Ihnen schmerzten die Beine. Dann sahen sie die rettende Tür. Sie öffnete sich einen Spalt. Förmlich warfen sie sich dagegen und stolperten übereinander in einen kleinen Wohnungsflur. Es roch nach Keksen und Gemütlichkeit.
Hinter ihnen schloss eine kleine alte Dame behutsam die Tür. „Bei mir seid ihr in Sicherheit. Setzt euch doch erst mal. Kann ich euch ein paar Kekse anbieten? Sie sind auch ohne Rosinen. Ich weiß ja, dass ihr sie nicht mögt.“
An der Tür kratzte und schabte es. Sie hörten Otto, der mit lauter Stimme Befehle erteilte: „Bewacht die Tür, ihr dummen Küken! Jetzt sind sie bei IHR!“
Die vier sahen sich an. „Habt ihr Angst?“ fragte die kleine alte Dame liebenswürdig.
„Ja“, antworteten sie im Chor.
„Gut. Aber noch nicht annähernd genug.“
Ralf verschluckte sich an seinem Keks.
Der Kampf beginnt.
…wird fortgesetzt…
Vor etwas mehr als acht Monaten fand ich dank Twitter die tollste Frau der Welt. Alles begann mit zwei belanglosen Tweets, auf die der jeweils andere reagierte. Aus Replys wurden bald Direktnachrichten und schließlich der Gedanke an ein Treffen. Wir hatten bis dahin weder telefoniert noch anderweitig Kontakt gesucht als über Twitter.
Wir verabredeten uns für einen Nachmittag und ich blieb fast für eine Woche. Seit dem ersten Treffen sehen wir uns nun an jedem Wochenende, und das macht mich zum glücklichsten Menschen der Welt. Die auf Twitter oft verschriene Pärchenscheiße war nur eklig, bis sie kam, und sie ist der erste Mensch, bei dem ich nach längerem Rund-um-die-Uhr-Kontakt nicht das Bedürfnis habe, nun mal wieder für mich allein zu sein. Bei ihr bin ich zuhause, bei ihr bin ich ganz ich. Wir tun uns gegenseitig gut.
Seitdem benutzen wir Twitter gemeinsam, wenn man das so nennen mag. Wir zeigen uns gegenseitig Tweets aus der eigenen Timeline, wir starten gemeinsam Meme, wir hoffen auf Replys von nervigen Leuten, wir trollen unsere Follower mit ironisch gemeinten Tweets, wir lästern über andere, wir erstellen Videos und teilen sie, kurzum: wir haben Spaß. Twitter hilft, Gesprächspausen zu überbrücken, und Twitter dient auch als eine Art Rückzugsort, in den man kurz verschwinden kann, wenn hier draußen alles zu viel wird.
Aber das Medium, das uns zusammenbrachte, trennt uns auch immer wieder, wenngleich zum Glück nur temporär, für Augenblicke, Momente. Wir greifen hin und wieder zum Smartphone, wenn wir frühstücken, wenn wir einen Film schauen, wenn wir ausgehen, wenn wir im Café sitzen. Es ist ein kleines Timeout, so als würde einer von uns zur Tür rausgehen, kurz andere Leute treffen, und dann wieder reinkommen, als wäre nichts geschehen. Die Welt steht kurz still, der Raum wird gebrochen, einer fällt aus der Zeit.
Manchmal erhalten wir Nachrichten, Replys, DMs, E‑Mails, dann kommt jemand zur Tür herein, setzt sich frech zwischen uns ins Wohnzimmer oder an den Frühstückstisch, plaudert nur mit einem von uns, verdrängt den anderen aus der Welt, und verschwindet wieder so plötzlich, wie er aufgetreten ist.
Wir beäugen manchmal das Smartphone des jeweils anderen, wenn es ein Geräusch macht, wie einen Eindringling. Wir sind dann nicht wirklich allein, unter uns, zumindest kommt es mir zuweilen so vor. Da sind immer die Anderen, entweder passiv, indem sie einfach greifbar, lesbar, verfügbar sind, oder aktiv, indem sie mit einem von uns kommunizieren. Das ist auf seine Art schön, hin und wieder; als Dauerzustand verändert es jedoch die kostbare Zweisamkeit. Soziale Medien werden zum Eindringling, weil wir sie eindringen lassen, selbst in unsere Köpfe. Nicht selten denkt einer von uns oder wir beide bei einer Äußerung, einem Anblick, einer Kuriosität: „Das wäre ein schöner Tweet“. Wie ein Fotograf, der keine Landschaften und keine Menschen mehr sieht, nur noch potentielle Fotos. Man kann die Momente zwar laufend teilen, ruiniert sie dadurch aber auch.
Ich komme mir blöd vor, es zu erwähnen, weil es mir lächerlich erscheint, aber ich komme mir genauso vor, wenn ich es nicht tue, weil es mich doch stört.





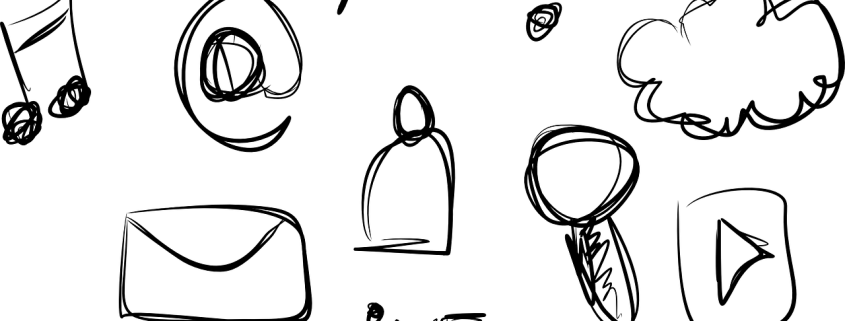
Neueste Kommentare