Wo immer nämlich diese Gesellschaft nicht funktioniert, wo immer sie versagt, wird ihr Versagen an den Ärmsten offenbar.
Jede Veränderung im sozialen Raum, jede Verschärfung des Wettbewerbs, jede Zunahme an Gewalt im öffentlichen Leben, jede Kontaminierung billigen Essens hinterlässt in der Lebenserfahrung von Armen ihre Spuren. Auch wie Gesellschaft sich verändert, in ihren Klassen- und Geschlechtsverhältnissen ebenso wie in ihrer Mitmenschlichkeit, das erfahren die Armen zuerst. Sie werden deshalb eben nicht nur materiell und gesundheitlich, sie werden auch psychologisch und moralisch am empfindlichsten von den Einbußen der Gesellschaft getroffen.
In der Armut wird das Selbstbild der Gesellschaft gekränkt und bestätigt: gekränkt, weil sie ihre idealen Bilder ohne Rückstände produzieren möchte, bestätigt, weil sie diese Armut ja selbst herstellt, die Produktion von Armut also genau so forciert wie ihr Pendant, den Wohlstand.
In dieser Kultur, und das heißt auch in den Beziehungen der Menschen untereinander, hat sich der Wert der Verkäuflichkeit und Käuflichkeit derart verselbständigt, dass Menschen schon degradiert werden, weil sie nicht am Warenverkehr teilnehmen können oder wollen. Jede Gesinnung, jedes Phänomen, jede Erscheinung, jede menschliche Hervorbringung, jede Leistung wird auf optimale Verkäuflichkeit untersucht und abgerichtet. Unvorstellbar, welche Kultur sich entwickeln könnte, wenn nicht jede Lebensregung an ihrer Markttauglichkeit gemessen, wenn Zugang zur Öffentlichkeit nicht nur Dingen verschafft würde, die sich verkaufen lassen, wenn, mit einem Wort, jeder täte, was er gesellschaftlich für wichtig, und nicht, was er für profitabel hielte. Eine Utopie mehr.
(Roger Willemsen – Der Knacks)
Und niemand versteht besser anzutreiben, niemand versteht höhnischer zu sagen: »Schlapper Hund! Solltest mich mal sehen!« als der Mit-Tote, als der Mit-Prolet, als der Mit-Hungernde, als der Mit-Gepeitschte. Selbst die Galeerensklaven haben ihren Stolz und ihr Ehrgefühl, sie haben den Stolz, gute Galeerensklaven zu sein und ›nun einmal zu zeigen‹, was sie können. Wenn das Auge des Kommandorufers, der mit der Peitsche die Reihen entlanggeht, wohlgefällig auf ihm ruht, so ist er beglückt, als hätte ihm ein Kaiser persönlich einen Orden an die Brust geheftet.
(B. Traven – Das Totenschiff)
Der irreparable Mensch ist der Mensch, der das Chaos hinter sich hat, und die Ordnung in der Marotte, in der Konvention, in den Tröstungen der Gewohnheit, im Tic, in der Routine, im Stil findet. Er wird nichts mehr. Kultivierte er früher vielleicht noch das aufklärerische Ideal, das Ich-Gebilde müsse stetig, plausibel, aus sich heraus entwickelt aufsteigen, so blamiert das Selbstbild im Knacks jede Vorstellung einer sich zielgerichtet entwickelnden Persönlichkeit. Am Ende erweist er sich als allenfalls amüsierbar.
(Roger Willemsen – Der Knacks)
Unsere Meinung, dass wir das andere kennen, ist das Ende der Liebe, jedesmal, aber Ursache und Wirkung liegen vielleicht anders, als wir anzunehmen versucht sind – nicht weil wir das andere kennen, geht unsere Liebe zu Ende, sondern umgekehrt: weil unsere Liebe zu Ende geht, weil ihre Kraft sich erschöpft hat, darum ist der Mensch fertig für uns. Er muß es sein. Wir können nicht mehr! Wir kündigen ihm die Bereitschaft, auf weitere Verwandlungen einzugehen. Wir verweigern ihm den Anspruch alles Lebendigen, das unfaßbar bleibt, und zugleich sind wir verwundert und enttäuscht, dass unser Verhältnis nicht mehr lebendig sei. „Du bist nicht“, sagt der Enttäuschte oder die Enttäuschte, „wofür ich dich gehalten habe“. Und wofür hat man sich denn gehalten? Für ein Geheimnis, das der Mensch ja immerhin ist, ein erregendes Rätsel, das auszuhalten wir müde geworden sind. Man macht sich ein Bildnis. Das ist das Lieblose, der Verrat.
(Max Frisch – Tagebuch 1946–1949)
What if the water that came out of the shower was treated with a chemical that responded to a combination of things, like your heartbeat, and your body temperature, and your brain waves, so that your skin changed color according to your mood? If you were extremely excited your skin would turn green, and if you were angry you’d turn red, obviously, and if you felt like shiitake you’d turn brown, and if you were blue you’d turn blue.
Everyone could know what everyone else felt, and we could be more careful with each other, because you’d never want to tell a person whose skin was purple that you’re angry at her for being late, just like you would want to pat a pink person on the back and tell him, „Congratulations!“
Another reason it would be a good invention is that there are so many times when you know you’re feeling a lot of something, but you don’t know what the something is. Am I frustrated? Am I actually just panicky? And that confusion changes your mood, it becomes your mood, and you become a confused, gray person. But with the special water, you could look at your orange hand and think, I’m happy! That whole time I was actually happy! What a relief!
(Jonathan Safran Foer – Extremely Loud & Incredibly Close)

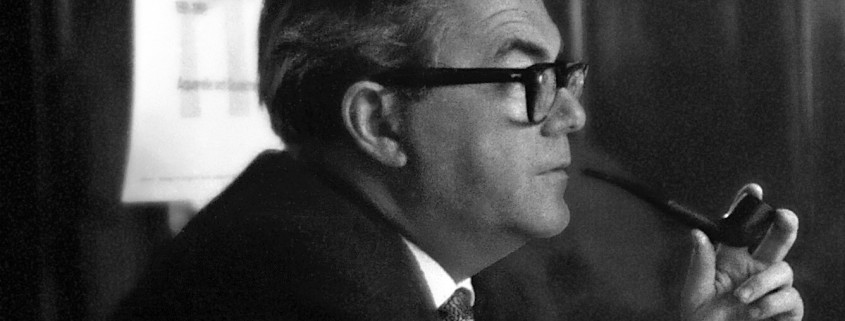
Neueste Kommentare