„Als Vermittlungsglied zwischen der Position oder Stellung innerhalb des sozialen Raumes und spezifischen Praktiken, Vorlieben, usw. fungiert das, was ich »Habitus« nenne, das ist eine allgemeine Grundhaltung, eine Disposition gegenüber der Welt, die zu systematischen Stellungnahmen führt“ (Bourdieu, 1992b, S. 31).
Der Begriff »Habitus« findet nicht nur in der sozialwissenschaftlichen Forschung, sondern auch im alltäglichen Sprachgebrauch rege Verwendung. Doch was genau ist eigentlich darunter zu verstehen? Wie hängen Handlungen, Sprach- und Kleidungsstil, Gestik und Gedanken von der Stellung im sozialen Gefüge ab und warum? Wie funktioniert Gesellschaft und ist der Einzelne Opfer der äußeren Umstände oder deren Erzeuger? Mögliche Antworten auf diese und ähnliche Fragen liefert Pierre Bourdieus Habituskonzept, das den zuvor schon gebräuchlichen »Habitus«-Begriff aufgegriffen, diesen folglich nicht erfunden, aber zu einer eigenen Theorie entwickelt hat (zur Entstehungsgeschichte vgl. beispielsweise Bourdieu 2000 oder Krais/Gebauer 2002).
Das von Bourdieu ausgearbeitete Habituskonzept beschreibt ein System von Grenzen und Möglichkeiten im Verhalten von Menschen, das ein System von Wahrnehmungs- und Urteilsschemata und dabei „gleichzeitig ein System von Schemata der Produktion von Praktiken und ein System von Schemata der Wahrnehmung und Bewertung der Praktiken“ (Bourdieu 1992a, S. 144) ist. Als solches System der Grenzen und Möglichkeiten im Verhalten bringt der Habitus bestimmte Formen des Geschmacks – der durchaus auch körperlich zu verstehen ist – sowie des Lebensstils hervor: „wie einer spricht, tanzt, lacht, liest, was er liest, was er mag, welche Bekannte und Freunde er hat usw. – all das ist eng miteinander verknüpft“ (Bourdieu 1992b, S. 32). Dieser individuelle Geschmack, diese Vorlieben und Handlungs- sowie Denkschemata, also die gesamten Habitusstrukturen eines Akteurs, sind dabei abhängig von der jeweiligen sozialen Situation, in der sich ein Akteur wiederfindet, d.h. von dessen Position im sozialen Raum und der Ausstattung mit ökonomischem wie kulturellem Kapital. Wer in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen ist, wird sich in der Regel anders verhalten als ein Kind aus einer Manager- oder Künstlerfamilie, um nur einige recht gegensätzliche Positionen des sozialen Spektrums heranzuziehen. Aufgrund des jeweiligen Sozialisationsmilieus wird der Mensch einen anderen Geschmack entwickeln, sowohl in Hinblick auf Kleidung, Speisen, Ästhetik und allgemeine Lebensführung, er wird andere Freizeitbeschäftigungen bevorzugen, eine andere Sprache gebrauchen, einen anderen Eindruck der Welt aufweisen, andere Zukunftswünsche hegen und einen anderen Freundeskreis entwickeln, der ihm als soziales Kapital dienen kann. Über die eng mit der sozialen Lage verknüpften Erfahrungen, vor allem jene der selbstverständlichen Verfügbarkeit verschiedener Kapitalarten oder im Gegenteil deren Mangel, begründet sich folglich der individuelle Habitus, der dabei zugleich auch eine Ableitung eines generalisierten Habitus einer bestimmten sozialen Lage ist, weil Akteure unter ähnlichen sozialen Bedingungen in der Regel auch ähnliche Habitus ausbilden, da sie kollektive Erfahrungen gemein haben: „Wer in der Wohlhabenheit, in ökonomischem und kulturellem Reichtum, in der damit gegebenen Sicherheit und Freiheit aufgewachsen ist, entwickelt nicht nur einen anderen Geschmack, sondern auch ein anderes Verhältnis zur Welt als jemand, der von frühester Kindheit an mit Not und Notwendigkeit (…) konfrontiert war“ (Krais/Gebauer 2002, S. 43). Die mit der individuellen sozialen Lage verbundenen ungleichen Sozialisationserfahrungen führen dabei zu unterschiedlichen Denkschemata des jeweiligen Akteurs, zu „Grenzen seines Hirns, die er nicht überschreiten kann“, weswegen „für ihn bestimmte Dinge einfach undenkbar“ (Bourdieu 1992b, S. 33) sind, sodass der einzelne Akteur „eher abhängig von Bedingungen und Zufällen als von eigenen Entscheidungen und Plänen [ist] – bzw. genauer: sich auch in seinen Entscheidungen und Plänen an den ihm je zugänglichen Möglichkeitsräumen“ (Liebau 2009, S. 49) orientiert.
Das Habituskonzept erklärt das Zustandekommen menschlicher Dispositionen, Verhaltensweisen und Geschmäcker mit einer doppelten Geschichtlichkeit, die im jeweiligen individuellen Habitus inkorporiert, also einverleibt wird. Dies ist zum einen die persönliche Geschichte, auch Erfahrung genannt, und zum anderen die Geschichte der gesellschaftlichen Wirklichkeit, vermittelt über die persönliche Geschichte, was bedeutet, dass „Lernprozesse nicht anders denn als Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit der Welt begriffen werden“ (Krais/Gebauer 2002, S. 61) können. Diese Inkorporierung der doppelten Geschichtlichkeit – die tatsächlich auch im wörtlichen Sinne körperlich stattfindet, sich also beispielsweise in Haltung, Sprechweise, Geschmack und Gestik manifestiert – erzeugt innerhalb derjenigen sozialen Verhältnisse, die diesen Habitus (aus)bilden, das Gefühl von Selbstverständlichkeit und gegenseitigem Verstehen beim Handeln, da die im Habitus inkorporierte soziale Wirklichkeit mit der umgebenden sozialen Wirklichkeit übereinstimmt, denn „[d]ie soziale Realität existiert sozusagen zweimal, in den Sachen und in den Köpfen, in den Feldern und in den Habitus, innerhalb und außerhalb der Akteure“ (Bourdieu & Wacquant 1996, S. 161). Eine gesellschaftliche Klasse beispielsweise als konkrete Form ähnlicher sozialer Verhältnisse ist „untrennbar zugleich eine Klasse von biologischen Individuen mit demselben Habitus als einem System von Dispositionen, das alle miteinander gemein haben, die dieselben Konditionierungen durchgemacht haben“ (Bourdieu 1987a, S. 112). Der individuelle Habitus stellt dabei eine Variante, eine Teilmenge eines solchen Klassenhabitus dar, „das heißt, das Individuum hat wesentliche Elemente seines Habitus mit dem seiner Klassengenossen gemeinsam“ (Krais/Gebauer 2002, S. 37; vgl. Liebau 2009), da sie durch ähnliche Existenzbedingungen geprägt wurden und weiterhin geprägt werden (vgl. Bourdieu 2011b), wobei der individuelle Habitus die grundlegenden Strukturen und Dispositionen des Klassenhabitus beinhaltet, aber aufgrund der Vielfältigkeit möglicher Lebenserfahrungen und sozialer Stellungen sowie der damit einhergehenden Besonderheit der spezifischen persönlichen Lebensläufe individuell verschieden ist: „[J]edes System individueller Dispositionen ist eine strukturale Variante der anderen Systeme, in der die Einzigartigkeit der Stellung innerhalb der Klasse und des Lebenslaufs zum Ausdruck kommt“ (Bourdieu 1987a, S. 113). Dieses Prinzip der strukturalen Variante eines grundlegenden Gruppenhabitus kann analog für das analytische Konstrukt objektiver sozialer Milieus herangezogen werden, sofern deren Akteure jeweils unter ähnlichen Existenzbedingungen leben und entsprechende Erfahrungen durchlaufen haben.
Entsprechend lassen sich schematisch drei grundlegende Habitusstrukturen identifizieren, die unterschiedlichen Positionen im sozialen Raum zugeordnet werden können, nämlich zum einen der Habitus der Distinktion, der Habitus des Strebens sowie der Habitus der Not(wendigkeit) (vgl. Hartmann 2004, S. 90; Bourdieu 1992b).
In den unteren Milieus lässt sich aufgrund fehlender ökonomischer Ressourcen und einer entsprechend eingeschränkten Zukunftssicherheit vor allem der Habitus der Not vorfinden, auch als ‚praktischer Materialismus‘ bezeichnet, der aus der Not geboren, infolgedessen daran angepasst und auf das Hier und Jetzt ausrichtet ist, auf das „Gegenwärtigsein im Gegenwärtigen“ (Bourdieu 1982, S. 297; vgl. Krais/Gebauer 2002): „Aus der Not heraus entsteht ein Not-Geschmack, der eine Art Anpassung an den Mangel einschließt und damit ein Sich-in-das-Notwendige-fügen, ein Resignieren vorm Unausweichlichen“ (Bourdieu 1982, S. 585).
Demgegenüber ist in den kleinbürgerlichen Milieus der Mitte der Habitus des Strebens vorherrschend. Er ist auf Aufstieg fokussiert und daher in Kontrast zum Habitus der Not nicht auf den Augenblick, sondern vielmehr auf die Zukunft ausgerichtet, was gegenwärtigen Verzicht bis hin zur Askese zugunsten zukünftiger Erträge und Befriedigungen im Sinne der Realisierung der Aufstiegsaspirationen einschließt. Der im Vergleich mit den oberen Milieus relative Mangel an Ressourcen wird durch Habitusdispositionen wie Ehrgeiz zu kompensieren versucht: „[V]erhältnismäßig arm an ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital, kann sie [die kleinbürgerliche Mittelschicht; MM] ihre ›Ansprüche‹ nur ›nachweisen‹ und sich damit Aussichten auf deren Realisierung eröffnen, wenn sie bereit ist, dafür durch Opfer, Verzicht, Entsagung, Eifer, Dankbarkeit — kurz: durch Tugend zu zahlen“ (Bourdieu 1982, S. 528). Dies führt sowohl zu oftmals sehr bemühten und daher unsicheren Anknüpfungsversuchen an die Praxen oberer Milieus als auch zu Abgrenzungsbestrebungen gegenüber unteren sozialen Lagen.
Der Habitus der Distinktion wiederum ist in der Regel den Milieus der Oberschicht vorbehalten. Er ist geprägt durch und prägt seinerseits die herrschende Kultur, was sich in strikter Abgrenzung und entsprechendem Abstand nach unten manifestiert (vgl. Bourdieu 1992b, S. 39). Im Gegensatz zu den Anknüpfungsbemühungen der mittleren Milieus, die gerade durch ihr Streben nach Zugehörigkeit zur herrschenden Kultur ihre Nichtzugehörigkeit offenbaren, zeichnen sich die Habitus der oberen Milieus durch eine Selbstverständlichkeit und Selbstsicherheit im Umgang mit Hoch- bzw. legitimer Kultur aus: „Diese Souveränität, die den spielerischen Umgang mit den gültigen Regeln beinhaltet, macht die entscheidende Differenz aus zwischen denen, die dazu gehören, und denen, die nur dazugehören möchten“ (Hartmann 2004, S. 142). Distinktion entsteht hier nicht durch Distinktionsbemühen, sondern – in Anlehnung an die soziale Magie der symbolischen Wirksamkeit dieses selbstverständlichen Verhaltens – ‚automagisch‘ durch den Umstand, dass „man nicht auf Distinktion, auf Sich-unterscheiden-wollen aus ist: die ›wirklich distinguierten‹ Leute sind die, die sich nicht darum kümmern, es zu sein“ (Bourdieu 1989, S. 18), da ihr Habitus milieuspezifisch-selbstverständliche Praxen hervorbringt, die ohne bewusstes Abgrenzungsbemühen des Akteurs Distinktion bewirken.
Ein Akteur handelt folglich innerhalb jener sozialen Verhältnisse, die seinem Habitus entsprechen und dessen Strukturen strukturier(t)en, innerhalb seines Milieus oder seiner Klasse vollkommen intuitiv und generativ kreativ gemäß der entsprechenden Logik der gesellschaftlichen Praxis und kann sich ohne bewussten Rückgriff auf bestimmte Regeln oder Normen „wie ein Fisch im Wasser“ (Bourdieu/Wacquant 1996, S. 161) in dieser Umgebung bewegen, auf die er objektiv abgestimmt ist, ohne dass jedoch eine explizite Absprache oder direkte Interaktion zwischen den Akteuren (vgl. Bourdieu 1987a, S. 109) noch eine subjektive Zweckausrichtung stattfände: „Dies kann in dem Gefühl zum Ausdruck kommen, genau »am richtigen Platz« zu sein, genau das zu tun, was man zu tun hat, und es auf glückliche Weise – im objektiven wie im subjektiven Sinne – zu tun oder in der resignierten Überzeugung, nichts anderes tun zu können, auch eine freilich weniger glückliche Weise, sich für das, was man tut, geschaffen zu fühlen“ (Bourdieu 2011a, S. 31f). Der jeweilige Akteur als Inhaber eines bestimmten Habitus fühlt sich demzufolge gemäß einer Art „sense of one’s place“ (Goffman zitiert nach Bourdieu 1992a, S. 141) in einer Umwelt am besten aufgehoben und zugehörig, die in ihrem kollektiven Habitus am ehesten seinem individuellen Habitus entspricht, d.h. der Habitus „bewirkt, daß man hat, was man mag, weil man mag, was man hat“ (Bourdieu 1982, S. 286) — „einen Umstand, den Bourdieu auch als »amor fati« bezeichnet, als Wahl oder Annehmen des Schicksals“ (Krais/Gebauer 2002, 43). Durch dieses Gespür für den »richtigen« Platz, die damit verbundene Akzeptanz des eigenen »Schicksals« und die unbewusste »Wahl« einer dem persönlichen Habitus entsprechenden Umwelt „schützt sich der Habitus vor Krisen und kritischer Befragung, indem er sich ein Milieu schafft, an das er so weit wie möglich vorangepaßt ist, also eine relativ konstante Welt von Situationen, die geeignet sind, seine Dispositionen dadurch zu verstärken, daß sie seinen Erzeugnissen den aufnahmebereitesten Markt bieten“ (Bourdieu 1987a, S. 114). Es wird dadurch ein sozialer Zusammenhang hergestellt, der unbewusst verbindet, d.h. „[d]er soziale Zusammenhalt wird immer wieder gestiftet durch die Wahlverwandtschaften, die sich aus einem gemeinsamen Habitus und Geschmack ergeben und die sich in (…) Handlungsgemeinschaften verkörpern“ (Vester et al. 2001, S. 169).
Das Habituskonzept und darauf aufbauende Konzepte begreifen „die Individuen weder als bloße Objekte vorgegebener objektiver Strukturen noch als völlig freie Subjekte, sondern in der Wechselwirkung ihrer Beziehungen, in denen sie beides sind“ (Vester et al. 2001, S. 150). Gleichzeitig wird das Individuum als ein von Geburt an vergesellschafteter Akteur betrachtet, womit das Habituskonzept die künstliche Entgegensetzung von Individuum und Gesellschaft überwindet: „Man wird nicht Mitglied einer Gesellschaft, sondern ist es von Geburt an (…) und von Geburt an befindet man sich in einer aktiven Auseinandersetzung mit der Welt“ (Krais/Gebauer 2002, S. 61). Auf diese Weise wird eine Brücke zwischen Individuum und Gesellschaft, zwischen Strukturalismus und Konstruktivismus geschlagen, die eine gegenseitige Beeinflussung bedingt sowie die unbewusste und objektiv aufeinander abgestimmt erscheinende Verhaltensgrundlage für das völlig selbstverständliche und angepasste Interagieren zwischen Akteuren mit mehr oder weniger homogenen Habitus erlaubt, die auf ebenso mehr oder weniger homogenen Existenzbedingungen basieren. Der Habitus ist demzufolge strukturierte und strukturierende Struktur zugleich, die „konstant auf praktische Funktionen ausgerichtet ist“ (Bourdieu/Wacquant 1996, S. 154), denn „[m]it dem Habitus sind wir in der Welt und haben die Welt in uns“ (Krais/Gebauer 2002, S. 61) — während »die Welt in uns«, verstanden als weitgehend selbstverständliche Inkorporierung der doppelten Geschichtlichkeit, die Strukturen des Habitus strukturiert, mit dem wir in der Welt sind, also „zur Ausbildung einer situationsangepassten Rationalität, eines praktischen Sinns [führt], der ‚weiß‘, was in welcher Situation zu tun und was zu lassen ist“ (Liebau 2009, S. 47), strukturiert der Habitus wiederum auf dieser Grundlage das Handeln und damit letztlich die gesellschaftliche Welt. Mittels der strukturierten und strukturierenden Struktur des Habitus erklärt sich, wie Gesellschaft überhaupt zustande kommt, ohne dass sämtliche beteiligte Akteure bewusst oder zielgerichtet auf das Herstellen einer gesellschaftlichen Ordnung oder das gesellschaftliche Funktionieren an sich hinarbeiten, wie Gesellschaft demnach ganz beiläufig entsteht, indem die Akteure ihren alltäglichen Handlungen nachgehen und damit „ununterbrochen dazu bei[tragen], die soziale Struktur zu reproduzieren“ (Bourdieu/Wacquant 1996, S. 174), denn der Habitus stellt
„strukturierte Strukturen [dar], die wie geschaffen sind, als strukturierende Strukturen zu fungieren, d.h. als Erzeugungs- und Ordnungsgrundlagen für Praktiken und Vorstellungen, die objektiv an ihr Ziel angepaßt sein können, ohne jedoch bewußtes Anstreben von Zwecken (…) vorauszusetzen, die objektiv »geregelt« und »regelmäßig« sind, ohne irgendwie das Ergebnis der Einhaltung von Regeln zu sein, und genau deswegen kollektiv aufeinander abgestimmt sind, ohne aus dem ordnenden Handeln eines Dirigenten hervorgegangen zu sein“ (Bourdieu 1987a, S. 98).
Der Habitus wird allgemein durch die gesellschaftlichen Bedingungen und im Speziellen durch eine bestimmte, individuelle Komposition objektiv-realer Existenzbedingungen sowie entsprechender Sozialisationserfahrungen geformt und formt seinerseits wiederum die Gesellschaft, wobei er „jener Verkettung von »Zügen« zugrunde [liegt], die objektiv wie Strategien organisiert sind, ohne das Ergebnis einer echten strategischen Absicht zu sein“ (ebd., S. 116).
Die vom Habitus hervorgebrachten Handlungen sind demzufolge nicht „intellektuellozentrisch“ (Bourdieu/Wacquant 1996, S. 153) als rein rationale Strategien zu verstehen, denen eine exakte Bewertung von Erfolgschancen zugrunde liegt, sondern funktionieren „nach einer dem lebenden Organismus eigenen, das heißt nach einer systematischen, flexiblen, nicht mechanistischen Logik“ (Krais/Gebauer 2002, S. 34), die aufgrund der Prägung des Akteurs die objektiv unwahrscheinlichsten Praktiken als undenkbare aussortiert (vgl. Bourdieu 1987a, S. 100), womit der scharfen Trennung zwischen Körper und Geist sowie der Vorstellung vom Körper als lediglich passivem Speicher der Erfahrungen widersprochen wird, da der Körper vielmehr „als aktives [und soziales; MM] ›Ding‹ bei der Erzeugung jener spontanen, immer wieder variierten und kreativ neu erfundenen Akte der Individuen“ (Krais/Gebauer 2002, S. 34; vgl. Kalthoff 2004) auftritt: „Weil die Handelnden nie ganz genau wissen, was sie tun, hat ihr Tun mehr Sinn, als sie selber wissen“ (Bourdieu 1987b, S. 127).
In den Habitus gehen die Denk- und Sichtweisen, die Wahrnehmung, Weltanschauung etc. einer Gesellschaft bzw. einer gesellschaftlichen Lage ein, werden somit zur zweiten Natur des Akteurs, der nun aufgrund dieser Inkorporierung der sozialen Verhältnisse vollkommen selbstverständlich gemäß diesen handelt und dadurch die gesellschaftlichen Verhältnisse, die seinen Habitus hervorgebracht haben, wiederum reproduziert. Sowohl die persönliche als auch die gesellschaftliche Vergangenheit wirken in ihm in der Gegenwart fort und bestimmen sein Verhalten, allerdings „um den Preis des Vergessens“ (Krais 2004, S. 91) seiner Entstehung aus bestimmten sozialen Verhältnissen. Das Äußere der gesellschaftlichen Verhältnisse wird dementsprechend inkorporiert und zum Inneren, zum Körper gewordenen Sozialen (vgl. Bourdieu/Wacquant 1996, S. 161), und reproduziert auf die Weise des Veräußerlichens dieses Inneren wiederum objektive gesellschaftliche Strukturen. In einer sozialen Umwelt, die mit dem persönlichen Habitus der Akteure übereinstimmt, werden diese aufgrund der in ihrem Habitus inkorporierten Erfahrung rein intuitiv handeln und müssen in einer für sie neuen Situation nicht erst bewusst darüber nachdenken, was nun zu tun sei.
Je nach sozialer Lage bieten sich den einzelnen Akteuren unzählige Zukunftsmöglichkeiten, allerdings mit unterschiedlicher Eintritts- oder Realisierungswahrscheinlichkeit, d.h. „die Vielzahl möglicher Welten [ist] zu jedem Zeitpunkt durch die jeweils wirkliche Welt, durch die gegebenen sozialen Verhältnisse begrenzt“ (Krais/Gebauer 2002, S. 46), so wie es für manche soziale Gruppen wahrscheinlicher ist als für andere, beispielsweise sozial aufzusteigen oder eine Studienlaufbahn einzuschlagen. Über den Habitus und die darin inkorporierten Erfahrungen, die die sozialen Wahrscheinlichkeiten und damit auch die eigene wahrscheinliche Zukunft miteinschließen, richten die Akteure schließlich ihre Handlungen auf diejenige Zukunft aus, die objektiv am wahrscheinlichsten ist, und lassen sie dadurch in einer Art „Kausalität des Wahrscheinlichen“ (ebd.) Wirklichkeit werden, denn „[a]uch wenn [die sozialen Determinanten] nicht bewußt wahrgenommen werden, zwingen sie den einzelnen, sich nach ihnen, das heißt nach der objektiven Zukunft der betreffenden gesellschaftlichen Klasse auszurichten“ (Bourdieu/Passeron 1971, S. 44). Der individuelle Habitus leistet also innerhalb homologer gesellschaftlicher Verhältnisse auch die Vorwegnahme und gleichzeitige Herbeiführung einer wahrscheinlichen Zukunft, da die Handlungen und unbewussten Strategien des Habitus „stets die objektiven Strukturen zu reproduzieren trachten, aus denen sie hervorgegangen sind“ (Bourdieu 1987a, S. 114). Die wahrscheinliche Zukunft kann über den Habitus aus Erfahrung, „d.h. durch die bereits eingetretene Zukunft früherer Praktiken“ (ebd.), als eben solche antizipiert werden, weil die im Habitus inkorporierte Geschichtlichkeit oder Erfahrung mit den Bedingungen und der Geschichtlichkeit der sozialen Verhältnisse übereinstimmt, woraus sich eine Selbstverständlichkeit des Handelns ergibt.
Diese Selbstverständlichkeit des Handelns geht jedoch verloren, sobald die sozialen Verhältnisse nicht länger dem Habitus eines Akteurs entsprechen, sprich wenn die in den sozialen Institutionen objektivierte Geschichtlichkeit nicht länger mit der inkorporierten Geschichtlichkeit übereinstimmt, denn die bestehende Strukturierung des Habitus „schließt aus, dass er alles verarbeitet, was in der Welt ist“, also „nur Dinge aufnehmen und einbauen kann, für die er bereits eine Art ›Ankopplungsstelle‹ hat“ (Krais/Gebauer 2002, S. 64). Findet sich ein Akteur in einem sozialen Umfeld mit hochgradig abweichenden sozialen Bedingungen vor, entspricht seine einverleibte Geschichte oder Erfahrung nicht länger der institutionalisierten Geschichte seiner Umgebung, sein persönlicher Habitus entspricht also nicht länger den sozialen Verhältnissen und zeichnet sich durch eine Trägheit aus, da er für die Gegebenheiten der neuen sozialen Umwelt kaum Ankopplungsstellen aufweist. Da der Habitus zwar durchaus veränderbar ist und die ihm zugrunde liegende Inkorporierung ein Leben lang stattfindet (vgl. Krais/Gebauer 2002), er aber stets von seiner ursprünglichen Strukturierung durch die Primärsozialisation in einer Art anhaftendem »Stallgeruch« geprägt bleiben wird, tritt auf, was Bourdieu als hysteresis-Effekt bezeichnet (vgl. Bourdieu 1982, S. 238f), nämlich eine Trägheit des Habitus, der nun in einer völlig neuen Situation unter anderen sozialen Bedingungen nicht mehr angemessen ist, infolgedessen der Akteur sich nicht länger angemessen verhalten kann: „Seinen Habitus, der ja die persönliche und soziale Identität eines Individuums ausmacht, kann man nun, wenn sich die individuellen Lebensverhältnisse verändern, nicht einfach wechseln wie ein Kleid“ (Krais/Gebauer 2002, S. 46). Über längere Zeit wird sich der Habitus des Akteurs den neuen sozialen Verhältnissen zwar annähern, seinen »Stallgeruch« der Primärsozialisation durch das vorhergehende Milieu allerdings nicht vollständig ablegen können (vgl. Bourdieu 2000; Hartmann 2004, S. 92f; Krais 2004, S. 99f).
Zentral ist für Bourdieu die selbstverständliche Komplizenschaft zwischen Individuum und sozialen Verhältnissen oder Institutionen, die auch gesellschaftliche Zwänge darstellen können und in der Regel solche sind: „Wir sind über diesen Habitus (…) immer versucht, Komplizen der Zwänge zu sein, die auf uns wirken, mit unserer eigenen Beherrschung zu kollaborieren“ (Bourdieu 2001a, S. 166). Diese Komplizenschaft zwischen Akteur und den ihn umgebenden Strukturen wird durch eine entsprechende Sozialisation innerhalb dieser Strukturen, also durch den jeweiligen Habitus hergestellt, der es den Akteuren erlaubt, gesellschaftliche „Institutionen zu bewohnen (habiter)“ (Bourdieu 1987a, S.107). Dies bedeutet, dass jene objektiven Strukturen nur Bestand haben können, indem sie in den Akteuren wirken und von diesen verinnerlicht, bewohnt, angeeignet werden, die sie dadurch wiederum reproduzieren; folglich wird die „objektivierte, instituierte Geschichte nur dann geschichtliche Aktion, d.h. aktivierte, aktive Geschichte, wenn sie von Akteuren aufgenommen wird, die ihre eigene Geschichte dazu prädisponiert, sie auf sich zu nehmen“ (Bourdieu 2011a, S. 27). So können gesellschaftliche Strukturen wie z.B. Staat oder Schule nur funktionieren, indem die Akteure in gewisser Weise an sie glauben (vgl. praktischer Glaube und praktischer Sinn in Bourdieu 1987b), durch Sozialisation in diesen Strukturen deren Funktionsweise inkorporieren und über Habitus und praktischen Sinn mit ihnen in Komplizenschaft treten. Alle betreffenden Akteure teilen daher den ihnen habituell inkorporierten Glauben an die institutionellen Strukturen, was sich in der Anerkennung dieser Strukturen und der entsprechenden Teilnahme manifestiert, wobei sich dieses Teilnehmen allerdings nicht bewusst mit einer strukturfunktionalistischen Absicht vollzieht, sondern aufgrund der entsprechenden Habitus völlig selbstverständlich, intuitiv und größtenteils unbewusst, so wie man beispielsweise seine Kinder ganz selbstverständlich auf die Schule schickt. Auf diese Weise werden Praktiken und Regelmäßigkeiten der gesellschaftlichen Institutionen und Strukturen im Habitus der Individuen verankert, was ihnen das Bewohnen dieser gesellschaftlichen Strukturen ermöglicht, aber aufgrund der selbstverständlichen habituellen Verinnerlichung der sozialen Ordnung auch Macht- und Herrschaftsverhältnisse reproduziert. Durch diese Betonung der habituellen Komplizenschaft wird zudem deutlich, dass per se keine antagonistische Gegenüberstellung zwischen Individuum und Gesellschaft besteht und nicht Gesellschaft an sich als Zwang gegenüber den Individuen auftritt, sondern bestimmte Praktiken, Ordnungen, Strukturen, Institutionen und letztlich der eigene, vorwiegend unbewusste Glaube daran: „Nicht Gesellschaft als solche ist eine ›Zumutung‹, problematisch ist vielmehr Herrschaft. Und Herrschaft tritt nicht einfach von außen an das Individuum heran, sie ist, über den Habitus, immer auch in das Individuum selbst eingelagert“ (Krais/Gebauer 2002, S. 79).
Eine Absage etwa an gesellschaftliche Zwänge kann sich also nicht auf die objektiv erkennbaren Strukturen beschränken, sondern muss beim Subjekt beginnen, das diese objektiven Strukturen durch seinen Habitus, durch seine subjektiven Strukturen, reproduziert. Dies erfordert zunächst das Erkennen der Selbstverständlichkeit, mit der aufgrund der Inkorporierung der doppelten Geschichtlichkeit und – darin enthalten – der gesellschaftlichen Denk- und Sichtweisen gehandelt wird, und damit das Erkennen der Grenzen des eigenen Habitus. Bourdieu leistet genau dies, indem er den „Mechanismus der kulturellen Reproduktion“ offen nachzeichnet und in Entgegnung auf den Vorwurf des Determinismus erklärt, „daß die Intention der Aufdeckung gesellschaftlicher Zwänge emanzipatorisch ist. Das heißt nichts anderes, als daß man – getreu der alten Regel – auf die Welt nur einzuwirken vermag, wenn man sie kennt: Jeder neue Bestimmungsfaktor, der erkannt wird, eröffnet einen weiteren Freiheitsspielraum“ (Bourdieu 1992b, S. 46).
Ein solcher Freiheitsspielraum gegenüber den gesellschaftlichen Zwängen, die als unhinterfragte Notwendigkeiten in den sozialen Gebilden und Denkschemata wirken, kann demzufolge nur durch ihr Erkennen hergestellt werden (das nicht mit Anerkennung gleichzusetzen ist), denn „[d]ie wissenschaftliche Erkenntnis der Notwendigkeit schließt die Möglichkeit einer Aktion ein, die darauf abzielt, sie zu neutralisieren, und mithin eine mögliche Freiheit, während das Nichterkennen der Notwendigkeit deren Anerkennung in uneingeschränkter Form impliziert: Solange das Gesetz unerkannt ist, erscheint das Resultat des laisser-faire, des Komplizen des Wahrscheinlichen [somit das, was gemäß dieses unerkannten Gesetzes scheinbar »einfach so« passiert, was nicht hinterfragt und was als selbstverständlich erachtet wird; MM], als Schicksal, sobald es erkannt ist, als Gewalt“ (Bourdieu 2011a, S. 53f).
Literatur:
- Bourdieu, Pierre (1982). Die feinen Unterschiede. Frankfurt/M: Suhrkamp.
- Bourdieu, Pierre (1987a). Strukturen, Habitusformen, Praktiken. In: Pierre Bourdieu, Sozialer Sinn (S. 97–121). Frankfurt/M: Suhrkamp.
- Bourdieu, Pierre (1987b). Glaube und Leib. In Pierre Bourdieu, Sozialer Sinn (S. 122–146). Frankfurt/M: Suhrkamp.
- Bourdieu, Pierre (1989). Satz und Gegensatz. Über die Verantwortung des Intellektuellen. Berlin: Wagenbach.
- Bourdieu, Pierre (1992a). Sozialer Raum und symbolische Macht. In Pierre Bourdieu, Rede und Antwort (S. 135–154). Frankfurt/M: Suhrkamp.
- Bourdieu, Pierre (1992b). Die feinen Unterschiede (Interview). In Pierre Bourdieu, Die verborgenen Mechanismen der Macht (S. 31–47). Hamburg: VSA-Verlag.
- Bourdieu, Pierre (2000). Die zwei Gesichter der Arbeit. Interdependenzen von Zeit- und Wirtschaftsstrukturen am Beispiel der algerischen Übergangsgesellschaft. Konstanz: UVK.
- Bourdieu, Pierre (2001). Habitus, Herrschaft und Freiheit. In Pierre Bourdieu, Wie die Kultur zum Bauern kommt (S. 162–173). Hamburg: VSA-Verlag.
- Bourdieu, Pierre (2011a). Der Tote packt den Lebenden. In Pierre Bourdieu, Der Tote packt den Lebenden (Neuauflage) (S. 17–54). Hamburg: VSA-Verlag.
- Bourdieu, Pierre (2011b). Wie eine soziale Klasse entsteht. In Pierre Bourdieu, Der Tote packt den Lebenden (Neuauflage) (S. 97–122). Hamburg: VSA-Verlag.
- Bourdieu, Pierre / Jean-Claude Passeron (1971). Die Illusion der Chancengleichheit. Stuttgart: Klett.
- Bourdieu, Pierre / Loïc Wacquant (1996): Reflexive Anthropologie. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
- Hartmann, Michael (2004). Elitesoziologie. Frankfurt/M: Campus.
- Kalthoff, Herbert (2004). Schule als Performanz. In Steffani Engler & Beate Krais (Hrsg.), Das kulturelle Kapital und die Macht der Klassenstrukturen (S. 115–140). Weinheim und München: Juventa.
- Krais, Beate (2004). Habitus und soziale Praxis. In Margarete Steinrücke (Hrsg.), Pierre Bourdieu. Politisches Forschen, Denken und Eingreifen (S. 91–106). Hamburg: VSA-Verlag.
- Krais, Beate / Gunter Gebauer (2002). Habitus. Bielefeld: transcript.
- Liebau, Eckart (2009). Der Störenfried. Warum Pädagogen Bourdieu nicht mögen. In Barbara Friebertshäuser, Markus Rieger-Ladich, Lothar Wigger (Hrsg.), Reflexive Erziehungswissenschaft (2. Auflage) (S. 41–58). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Vester, Michael, Peter von Oertzen, Heiko Geiling, Thomas Hermann, & Dagmar Müller (2001). Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel. Frankfurt/M: Suhrkamp.

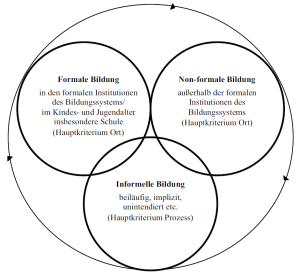
Neueste Kommentare