Die moderne Geschichte hat, denke ich, hinreichend bewiesen, dass jeder Mensch, oder fast jeder, unter gewissen Voraussetzungen das tut, was man ihm sagt; und, verzeiht mir, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass ihr die Ausnahme seid – so wenig wie ich. Wenn ihr in einem Land und in einer Zeit geboren seid, wo nicht nur niemand kommt, um eure Frau und eure Kinder zu töten, sondern auch niemand, um von euch zu verlangen, dass ihr die Frauen und Kinder anderer tötet, dann danket Gott und ziehet hin in Frieden. Aber bedenkt immer das eine: Ihr habt vielleicht mehr Glück gehabt als ich, doch ihr seid nicht besser. Denn solltet ihr so vermessen sein, euch dafür zu halten, seid ihr bereits in Gefahr. Gern stellen wir dem Staat – ob er totalitär ist oder nicht – den gewöhnlichen Menschen gegenüber, die Laus oder das kleine Licht. Dabei vergessen wir jedoch, dass der Staat aus Menschen besteht, mehr oder weniger gewöhnlichen Menschen, ein jeder mit seinem Leben, seiner Geschichte, jeder mit seiner Verkettung von Zufällen, die dafür gesorgt haben, dass er sich eines Tages auf der richtigen Seite des Gewehrs oder Dokuments wiederfindet, während andere auf der falschen stehen. Dieser Gang der Ereignisse ist in den seltensten Fällen das Ergebnis einer Entscheidung oder gar einer charakterlichen Veranlagung. Und die Opfer sind in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle nicht deshalb gefoltert oder getötet worden, weil sie gut waren, ebenso wenig wie ihre Peiniger sie aus Bosheit gequält haben. Das zu glauben wäre reichlich naiv; man braucht sich nur in einer beliebigen Bürokratie umzusehen, und sei es die des Roten Kreuzes, um sich davon zu überzeugen. (…) Die Maschinerie des Staates nun ist aus dem gleichen Sand gebacken wie das, was sie Korn für Korn zu Staub zermahlt. Es gibt sie, weil alle damit einverstanden sind, dass es sie gibt, sogar – und häufig bis zum letzten Atemzug – ihre Opfer. Ohne die Höß, Eichmanns, Goglidzes, Wyschinskis, aber auch ohne die Weichensteller, die Betonfabrikanten und die Buchhalter in den Ministerien wäre ein Stalin oder ein Hitler nur einer jener von Hass und ohnmächtigen Gewaltfantasien aufgeblähten Säcke gewesen.
Jonathan Littell – Die Wohlgesinnten
Schlagwortarchiv für: Politik
Ich entziehe einer Gesellschaft das Vertrauen, die aus Menschen besteht und trotzdem auf der Angst vor dem Menschlichen gründet. Ich entziehe einer Zivilisation das Vertrauen, die den Geist an den Körper verraten hat. Ich entziehe einem Körper das Vertrauen, der nicht mein eigenes Fleisch und Blut, sondern eine kollektive Vision vom Normalkörper darstellen soll. Ich entziehe einer Normalität das Vertrauen, die sich selbst als Gesundheit definiert. Ich entziehe einer Gesundheit das Vertrauen, die sich selbst als Normalität definiert. Ich entziehe einem Herrschaftssystem das Vertrauen, das sich auf Zirkelschlüsse stützt. Ich entziehe einer Sicherheit das Vertrauen, die eine letztmögliche Antwort sein will, ohne zu verraten, wie die Frage lautet. Ich entziehe einer Philosophie das Vertrauen, die vorgibt, dass die Auseinandersetzung mit existentiellen Problemen beendet sei. Ich entziehe einer Moral das Vertrauen, die zu faul ist, sich dem Paradoxon von Gut und Böse zu stellen und sich lieber an »funktioniert« oder »funktioniert nicht« hält. Ich entziehe einem Recht das Vertrauen, das seine Erfolge einer vollständigen Kontrolle des Bürgers verdankt. Ich entziehe einem Volk das Vertrauen, das glaubt, totale Durchleuchtung schade nur dem, der etwas zu verbergen hat. Ich entziehe einer METHODE das Vertrauen, die lieber der DNA eines Menschen als seinen Worten glaubt. Ich entziehe dem allgemeinen Wohl das Vertrauen, weil es Selbstbestimmtheit als untragbaren Kostenfaktor sieht. Ich entziehe dem persönlichen Wohl das Vertrauen, solange es nichts weiter als eine Variation auf den kleinsten gemeinsamen Nenner ist. Ich entziehe einer Politik das Vertrauen, die ihre Popularität allein auf das Versprechen eines risikofreien Lebens stützt. Ich entziehe einer Wissenschaft das Vertrauen, die behauptet, dass es keinen freien Willen gebe. Ich entziehe einer Liebe das Vertrauen, die sich für das Produkt eines immunologischen Optimierungsvorgangs hält. Ich entziehe Eltern das Vertrauen, die ein Baumhaus »Verletzungsgefahr« und ein Haustier »Ansteckungsrisiko« nennen. Ich entziehe einem Staat das Vertrauen, der besser weiß, was gut für mich ist, als ich selbst. Ich entziehe jenem Idioten das Vertrauen, der das Schild am Eingang unserer Welt abmontiert hat, auf dem stand: »Vorsicht! Leben kann zum Tode führen.«
Juli Zeh – Corpus Delicti
Während Bildung „im traditionellen Sinne (…) als die erarbeitende und aneignende Auseinandersetzung mit der Welt schlechthin und Inbegriff der Selbstverwirklichung des Menschlichen im Menschen“ (Büchner, 2003, S. 7) verstanden wird, die Selbstentfaltung und Emanzipation ermöglicht, zeigt sich im Alltag und der öffentlichen Debatte dagegen vielmehr, dass es vor allem die staatlich anerkannten Bildungsabschlüsse und ‑titel sind, d.h. institutionalisierte Bildung, die für die beruflichen Chancen und damit letztlich die soziale Statuszuweisung ausschlaggebend sind. Dieses Gewicht institutionalisierter Bildung verleitet zur Nutzung eines verkürzten Bildungsbegriffs, der Bildung auf die Inhalte und Abschlüsse eben jener institutionalisierten Bildungsgänge reduziert und damit kurzerhand Bildungsprozesse und ‑inhalte außerhalb schulischer Sphären negiert, womit die in Bildungserfolg und ‑misserfolg sich niederschlagende (In)Kompatibilität zwischen herkunftsspezifischer, im Habitus inkorporierter Bildung und den institutionalisierten Bildungsvorstellungen aus dem analytischen Blickfeld verschwindet: „Die häufig anzutreffende Gleichsetzung von Bildung und erworbenen Bildungspatenten, die auf der Grundlage standardisierter Bildungsinhalte erworben werden, verfehlt diejenigen Momente von Bildung, die quer zu den in der Schule vermittelten Bildungsformen und ‑inhalten liegen“ (Grundmann, Groh-Samberg, Bittlingmayer, & Bauer, 2003, S. 27; vgl. Bittlingmayer, 2006). Um eine derartige Verkürzung zu vermeiden, ist zunächst eine differenzierte Betrachtung und Gegenüberstellung der Begriffe Sozialisation, Bildung und Erziehung notwendig.
Sozialisation ist als allumfassender Begriff zur Beschreibung „der sozialen Gestaltung von verlässlichen Sozialbeziehungen und der intergenerationalen Tradierung sozialen Handlungswissen“ (Grundmann, 2011, S. 63) zu verstehen, auf dessen Grundlage die Begriffe Bildung und Erziehung auf die konkrete inhaltliche Ausgestaltung dieses Sozialisationsprozesses abheben. Sämtliche Handlungen und Prozesse, die dazu beitragen, einem Akteur die Eingliederung in seine soziale Umwelt zu ermöglichen, an deren gesellschaftlichem Leben teilzunehmen und teilzuhaben sowie sein Verständnis über diese Prozesse zu erweitern, sind als Sozialisation zu begreifen. Demgegenüber bezeichnet der Begriff Bildung die „Kultivierung von Handlungswissen einzelner Individuen“ (ebd.), Erziehung „die Etablierung sozial erwünschter Eigenschaften von Personen durch Bezugspersonen“ (ebd.); beide Begriffe dienen demzufolge zur inhaltlichen Konkretisierung und Differenzierung von Sozialisationsprozessen. Bildung ist gemäß dieser abstrakten Definition keineswegs beschränkt auf institutionalisierte Bildungsprozesse, sondern umfasst jede Art von Handlungswissen, die einem Akteur nachhaltig zur Einbindung in das soziale Leben verhilft, wobei dieses Wissen in schulischen Einrichtungen, durch Traditionen oder schlicht im alltäglichen Leben weitergegeben und erworben werden kann (vgl. Suderland, 2004) – nicht immer widerspruchsfrei. Wie dieser Fokus auf Einbindung in die gesellschaftliche Umwelt bereits nahelegt, orientieren sich sowohl Bildung, zumindest jene, die von außen zielgerichtet an ein Individuum herangetragen wird, als auch Erziehung an solchen Verhaltensweisen und Wissensbeständen, die den gegenwärtigen sozialen Normen und Vorstellungen, den Anforderungen und Einschränkungen der gesellschaftlichen Welt entsprechen, „indem sie vor allem jene Eigenschaften und Fähigkeiten in den Blick nehmen, die gesellschaftlich wertgeschätzt werden“ (Grundmann, 2011, S. 64), wodurch die zu Erziehenden und zu Bildenden entsprechend geformt und auf das gesellschaftliche Leben vorbereitet werden sollen. Somit verfolgen Bildung und Erziehung in der Regel mindestens implizit systemfunktionale Ziele, die den Rahmen für die Formen und Inhalte von Bildung vorgeben und eine mit diesem kompatible Erziehung bedingen. Unter Berücksichtigung des Stellenwerts schulischer Bildung ist selbige in der gegenwärtigen Gesellschaft mit ihrem Fokus auf formale Bildungsgänge und ‑abschlüsse „einer Funktionalisierung durch gesellschaftliche Institutionen“ (ebd., S. 70) unterworfen, die eine Erziehung bedingt, die – soweit ihr das möglich ist – versucht, den Anforderungen dieser Funktionalisierung durch Anpassung innerfamiliärer oder generell alltagspraktischer Bildungs- und Erziehungsprozesse entgegenzukommen, zum Beispiel durch gezielte Vorbereitung auf schulische Bildungsinhalte. Zu Spannungsverhältnissen kommt es dabei, wenn diese Bildungs- und Erziehungsprozesse der unmittelbaren Lebensumwelt, d.h. des Bezugs- und Herkunftsmilieus, jenen Bildungsanforderungen widersprechen, die von den gesellschaftlichen Institutionen gefordert und vorausgesetzt werden – sind die Bildungsinhalte der Schule für das alltägliche Leben eines Schülers irrelevant oder umgekehrt, passt also der Habitus des Schülers, der die herkunftsspezifischen Bildungsinhalte inkorporiert hat, nicht zu den institutionellen Erfordernissen, so entstehen Inkompatibilitäten, die in der Regel zu schulischem Misserfolg führen.
Zum Verständnis des Zustandekommens derartiger Inkompatibilitäten zwischen individuellem Habitus und schulischen Anforderungen ist eine weitere Differenzierung des Bildungsbegriffs notwendig (vgl. Abbildung), die der Verkürzung auf institutionelle Bildung entgegentritt.
Neben formaler, staatlich sanktionierter Bildung, die das Monopol über die Vergabe der in der Regel für die berufliche und soziale Position ausschlaggebenden Bildungstitel innehat und nicht nur strukturiert wie zielgerichtet, sondern ferner in eigens dafür geschaffenen, symbolisch wie auch juristisch legitimierten Institutionen mit hierarchischen Strukturen, vorgegebenen Regeln, ständiger Leistungszertifizierung und Teilnahmeverpflichtung stattfindet, kann strukturierte und zielgerichtete Bildung auch non-formal, außerhalb der formalen Bildungs- und Berufsbildungsinstitutionen vonstattengehen, beispielsweise in Vereinen, Nachmittagskursen, Verbänden oder in Form von Nachhilfeangeboten, wobei nebst eingeschränkter Zertifizierungsmöglichkeit dieser Art von Bildung die freiwillige, nichtverpflichtende Teilnahme an derartigen Bildungsangeboten das zentrale Charakteristikum non-formaler Bildung darstellt (vgl. Rohlfs, 2011). Nicht minder relevant ist allerdings das Lernen im informellen Kontext, das spontan vom individuellen Akteur ausgeht, sich ungeplant vollzieht und „indirekt und gewöhnlich anlassbezogen-sporadisch-zufällig, also situativ an akuten Einzelproblemen und deren Lösung orientiert, unzusammenhängend, vordergründig-utilitaristisch wie unkritisch-unreflektiert“ (Rohlfs, 2011, S. 39) ist. Zwar kann informelle Bildung bisweilen zertifiziert werden (man denke etwa an Kopfnoten), doch unterliegen die Bildungsprozesse an sich keiner Struktur oder Steuerung und folgen keinen formalen Vorgaben, die als Grundlage einer Bewertung nötig wären, sodass in der Regel keine Zertifizierung informeller Bildung möglich ist. Von entscheidender Bedeutung ist zudem, dass informelle Bildung „in der natürlichen (sozialen) Umwelt der Bildungsakteure“ (ebd.) stattfindet und sich dadurch auszeichnet, „dass Lernsituation und praktischer Verwendungszusammenhang zusammenfallen“ (Dravenau & Groh-Samberg, 2005, S. 118). Was auf derartige informell-situative Weise gelernt wird, weist stets unmittelbaren Bezug zur konkreten Lebenswelt des Akteurs auf (vgl. Grundmann, Bittlingmayer, Dravenau, & Groh-Samberg, 2007), sei es im Kontext der Lösung eines alltagspraktischen Problems oder der Kommunikation mit den umgebenden Mitmenschen, während formale Bildung einen solchen Alltagsbezug zwar aufweisen kann, dieser aber nicht selbstverständlich ist, da sich außer bei bildungsnaher Herkunft die „Lern- und Bildungsprozesse in der Familie deutlich von jenen unterscheiden, die in institutionalisierten Bildungseinrichtungen vorherrschen“ (ebd., S. 43) – als Beispiel sei hier nur auf das Lesen klassischer Literatur verwiesen, das für einen Schüler durchaus mit dessen Alltagspraxis kompatibel sein kann, sofern dieser in einem entsprechenden kulturellen Umfeld aufgewachsen ist; es verliert jedoch jegliche außerschulische Relevanz für einen Schüler, in dessen Alltagspraxen das Lesen an sich oder diese konkrete Form der Literatur (so gut wie) keine Rolle spielt. Dieses herkunftsspezifische kulturelle Erbe, das sich für das Passungsverhältnis mit der Schule verantwortlich zeichnet, wird, da die Vererbung in Form informeller Bildung stattfindet, „auf osmotische Weise übertragen, ohne jedes methodische Bemühen und jede manifeste Einwirkung“ (Bittlingmayer & Grundmann, 2006, S. 76).
Die hier vollzogene Trennung[1] in formale, non-formale und informelle Bildung soll trotz des großen Gewichts, das die formale Bildung in Hinblick auf beruflichen Erfolg und Statuszuweisung einnimmt, nicht zu einer Hierarchisierung der verschiedenen Erscheinungsformen von Bildung verleiten, sondern das oftmals auf institutionelle Bildung verengte Bildungsverständnis erweitern. Eine solche Hierarchisierung nämlich würde die Tatsache entwerten und negieren – womit nun seinerseits keine umgekehrte Hierarchisierung nahegelegt, sondern jede Form der Hierarchisierung an sich in Frage gestellt werden soll –, „dass der weitaus größte Teil aller menschlichen Lernprozesse (…) außerhalb der Bildungsinstitutionen stattfinde[t]“ (Rohlfs, 2011, S. 47). Bildung beginnt demzufolge nicht erst mit formalen Bildungsformen, sondern bereits mit den in den Habitus eingehenden alltäglichen Lern- und Bildungsprozessen eines Heranwachsenden in Familie und genereller Lebenswelt, die den Großteil der Erfahrungen nicht nur, aber besonders im Kindesalter ausmachen; gelernt wird also vorwiegend „durch Praxis, durch Nachmachen und Mittun, durch Aneignung von Routinen und Gewohnheiten und durch die dementsprechende Entwicklung von Denk‑, Wahrnehmungs‑, Urteils- und Handlungsmustern, die aus der Herkunftskultur stammen und in ihr Sinn haben“ (Liebau, 2009, S. 47).
Diese Ausführungen machen deutlich, dass die Aneignung von Bildung, d.h. das Lernen „nicht nur als bewusste kognitive, sondern auch als eher unbewusste psychische und gefühlsmäßige Verarbeitung von Eindrücken, Informationen, Erlebnissen etc.“ (Rohlfs, 2011, S. 36) verstanden werden muss, das sich „bewusst wie unbewusst, intentional wie beiläufig, theoretisch wie praktisch“ (ebd.) vollzieht. Bildungsprozesse, begriffen als Inkorporierung von Kultur, und das mit ihnen verbundene Lernen finden daher nur selten rein kognitiv, sondern vielmehr habituell statt – während formale Bildung eher auf der rationalen Ebene anzusiedeln ist, geschieht das grundlegende, informelle Lernen mehrheitlich beiläufig und ohne gezielte Intention, woraus weiteres Konfliktpotential erwachsen kann, weil etwaige Inkompatibilitäten zwischen formalen Bildungsanforderungen und Habitus infolgedessen nicht allein durch rationale Intervention oder Reflexion auflösbar sind.
Diese wesentlichen Unterschiede zwischen den formalen, in ausgewiesenen Bildungseinrichtungen stattfindenden und den informellen, sich in der Familie vollziehenden Bildungsprozessen machen deutlich, welch analytische Kurzsichtigkeit eine Verengung des Bildungsbegriffs auf institutionalisierte Bildungsprozesse zur Folge hat, die nur formalem Lernen einen Wert zumisst und „mit dem informellen Lernen eher «Nichtbildung» [assoziiert], weil Spiel und «tun und lassen können, was man will» mit Verschwendung von Bildungsressourcen gleichgesetzt wird“ (Dollase, 2007, S. 6; vgl. Rohlfs, 2011), womit all jene Bildungsformen, ‑prozesse und ‑inhalte jenseits der institutionellen Vorgaben und damit auch die daraus resultierenden Passungs- oder Konfliktverhältnisse ignoriert werden. Wenn nicht gar explizit, so liegt diesem auch in der empirischen Bildungsforschung verbreiteten hierarchischen Bildungsverständnis (dazu kritisch Grundmann, Bittlingmayer, Dravenau, & Groh-Samberg, 2007; Grundmann, 2011) doch zumindest implizit eine Defizitlogik zugrunde, die sämtliche herkunftsspezifischen Bildungsprozesse abwertet und als minderwertig betrachtet, solange diese nicht im schulischen Kontext anschlussfähig oder verwertbar sind, was gleichzeitig die dieser Hierarchisierung zugrundeliegende Vorstellung und den Anspruch reproduziert, bei schulischer Bildung handele es sich um die (einzig) legitime Form von Kultur (vgl. Bock, 2008; Grundmann, Groh-Samberg, Bittlingmayer, & Bauer, 2003). Wenngleich durch Zertifizierung, staatlich anerkannte Abschlüsse, Orientierung an Lehrplänen und weitgehende Standardisierung von Lernprozessen und ‑inhalten die schulische Bildung als legitime Bildung ausgewiesen ist, die für Statuszuweisung und als Qualifikationsnachweis für beruflichen Ein- oder Aufstieg herangezogen wird, so darf doch nicht übersehen werden, dass außerschulische Bildungsprozesse auch dann stattfinden, „wenn schulische Bildungsverläufe fehlschlagen, verkürzt oder abgebrochen werden“ (Grundmann, Groh-Samberg, Bittlingmayer, & Bauer, 2003, S. 27) – nur werden eben diese vermeintlich unnützen Bildungsprozesse und ‑inhalte selbst dann nicht als legitime Bildung anerkannt, wenn sie für den konkreten Akteur zum täglichen Überleben in Milieu und Gesellschaft von teils existentieller Bedeutung sind.
Wie hieran deutlich wird, bedingt die Formalisierung von Bildung nicht nur eine Hierarchisierung von Kultur, die mit dieser Institutionalisierung und der damit einsetzenden Abwertung außerschulischer Bildungsprozesse einhergeht, sondern formt Bildung generell zu einem „ökonomisch-politischen Instrument“, das vordergründig zwar mit den Versprechen von Emanzipation, Mündigkeit und Selbstverwirklichung maskiert wird, dabei allerdings nur „jene Kulturtechniken vermittelt [und akzeptiert; MM], die politisch und ökonomisch gewollt sind“ (Grundmann, 2011, S. 72). Erziehung erschöpft sich in diesem Sinne darauf, die Ausprägung eines möglichst schulkonformen Habitus zu fördern bzw. sicherzustellen, der sowohl ‚leistungsfähig‘ ist als auch die erwünschten Charakterzüge aufweist – „eine gute Erziehung zeichnet sich demnach durch optimale Vorbereitung auf die Schule aus“ (ebd., S. 70), demgegenüber eine Erziehung, die eine solche Vorbereitung nicht leisten kann (oder will), automatisch als defizitär betrachtet wird. Insofern kann von einem emanzipatorischen Element überhaupt nur dann die Rede sein, wenn die Bildungsanforderungen sich mit den eigenen Lebensentwürfen und – unmittelbar relevanter – den Anforderungen des täglichen Lebens decken oder diesen zumindest nicht widersprechen; in jedem anders gelagerten Fall findet das Gegenteil von Emanzipation statt, nämlich eine die soziale Hierarchie reproduzierende symbolische und strukturelle Gewalt, vermittelt über die Abwertung herkunftsspezifischer kultureller Praktiken, indem „Erziehung und Bildung (…) zur Selektion und Legitimation ungleicher Lebenschancen herangezogen“ (Grundmann, 2011, S. 64) werden.
Völlig unbeachtet bleiben bei der Verkürzung des Bildungsbegriffs und der damit verknüpften Hierarchisierung von Kultur die Perspektiven der betroffenen Akteure, die über eine jeweils eigene, herkunftsspezifische Kultur mit divergierenden Bildungsstrategien verfügen und diese in das institutionelle Bildungssystem hineintragen, wo ihnen aufgrund ihrer Anschlussfähigkeit entweder Akzeptanz entgegengebracht wird und sich ein Gefühl der selbstverständlichen Zugehörigkeit einstellen kann, oder infolge kultureller Differenz strikte Abwertung entgegenschlägt und ein diffuses Gefühl der Nichtzugehörigkeit entsteht, was u.a. das Phänomen der Selbsteliminierung zur Folge hat, also das scheinbar (!) freiwillige und selbstgewählte verfrühte Ausscheiden aus dem Bildungssystem oder die Beschränkung auf objektiv wenig ertragreiche, aber subjektiv als sicher empfundene Bildungswege. Wie deutlich geworden sein sollte, ist zum Verständnis dieses Passungsverhältnisses der „Bildungsbegriff aus seiner institutionellen Verankerung zu entgrenzen“ (Grundmann, Groh-Samberg, Bittlingmayer, & Bauer, 2003, S. 27), da nur mittels eines solchen breitgefassten Bildungsbegriffs, der unter Rückgriff auf das Habituskonzept die herkunftsspezifischen Bildungsstrategien und ‑inhalte im Kontext ihrer Lebenswelt beleuchtet und ernst nimmt, anstatt sie unter der Prämisse einer Defizitlogik abzuwerten, „diejenigen sozialisatorischen Alltagspraktiken, individuellen Handlungsbefähigungen und Handlungsstrategien sichtbar [gemacht werden können], die für die Reproduktion der sozial ungleichen Bildungserfolge sozialisatorisch verantwortlich sind und die in der Regel außerhalb der schulischen Alltagspraxis selbst liegen“ (Grundmann, Bittlingmayer, Dravenau, & Edelstein, 2006, S. 16; vgl. Bittlingmayer, 2006).
Wird der Bildungsbegriff von seiner Fixierung auf schulische Bildung gelöst und differenziert betrachtet, so muss auch der darauf aufbauende Begriff des Bildungserfolgs eine ähnliche Differenzierung erfahren, um unter anderem deutlich machen zu können, wie Bildungserfolg einer Lesart gegebenenfalls anderen Vorstellungen von Bildungserfolg – insbesondere jenen innerhalb des Bildungssystems – zuwiderlaufen kann.
Zunächst kann Bildungserfolg individuell-lebensweltlich begriffen werden, als allgemeine Handlungsbefähigung, um am alltäglichen Leben in der gegebenen Bezugswelt, d.h. dem umgebenden Milieu, teilnehmen und teilhaben zu können (vgl. Huisken, 2005; Bittlingmayer, 2006; Dravenau, 2006; Grundmann, 2006; Grundmann, Bittlingmayer, Dravenau, & Groh-Samberg, 2007; Bock, 2008; Grundmann, 2011). Bildungserfolg in diesem Sinne zeichnet sich dadurch aus, die milieuspezifischen Handlungs- und Umgangsformen, die alltäglichen Praxen wie auch sprachlichen Besonderheiten (etwa Umgangssprache oder Dialekt) zu erlernen und anwenden zu können, was in der Regel in Form von informeller Bildung geschieht und somit bei den Akteuren einen herkunftsspezifischen, an die konkreten Anforderungen angepassten Habitus herausbildet. Als erfolgreich gilt hier, wer sich aufgrund dieses Habitus in seinem Milieu als Zugehöriger und sich zugehörig Fühlender bewegen kann.
Weiterhin kann Bildungserfolg aus einer Perspektive verstanden werden, die Bildung als Bürgerrecht (vgl. Dahrendorf, 1966) oder gesamtgesellschaftlich-emanzipatives Element betrachtet, das sowohl den Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen ermöglicht als auch Grundlage für die aktive politische Teilnahme und damit letztlich die Gestaltung der Gesellschaft ist (vgl. Büchner, 2003; Huisken, 2005; Butterwegge, 2010; Quenzel & Hurrelmann, 2010; Grundmann, 2011). Nach diesem Verständnis ist Bildung nicht nur für die Handlungsbefähigung im direkten Milieu von zentraler Bedeutung, sondern ebenfalls essentieller Bestandteil der politischen Meinungsbildung und der Möglichkeit zur Einflussnahme auf gesellschaftliche Bedingungen. Wird Zugang zu Bildung verwehrt oder ist dieser sozial ungleich verteilt, hat dies nicht nur Konsequenzen für die individuellen Arbeitsmarktchancen und sämtliche damit verknüpften Auswirkungen auf die betroffenen Individuen, sondern bedeutet gleichzeitig eine Einschränkung der politischen Mit- oder bloß Selbstbestimmung, d.h. letztlich ein Ungleichgewicht demokratischer Partizipationsmöglichkeiten. Schulische Bildung kann mit derartigen Emanzipationsprozessen wiederum in Konflikt geraten, wenn diese beispielsweise die Regeln und Abläufe der schulischen Institutionen in Frage stellen.
Wie anfangs bereits dargelegt, wird Bildungserfolg in der Regel allerdings allein mit dem Erfolg oder Misserfolg innerhalb institutioneller Bildungseinrichtungen und den von diesen vergebenen Bildungszertifikaten gleichgesetzt, was auch von Teilen der soziologischen Bildungsforschung und vor allem den PISA-Studien übernommen wird (vgl. Becker & Hadjar, 2011; exemplarisch OECD, 2010). Dies entspricht einer systemfunktionalen Betrachtung im Kontext des Bildungssystems und des darauf aufbauenden Arbeitsmarkts; Bildungsungleichheiten an sich, wenn auch nicht zwingend soziale Ungleichheiten, werden aus dieser systemfunktionalen Perspektive heraus als notwendig erachtet und positiv bewertet, da unterschiedliche berufliche Positionen auch unterschiedliche schulische Abschlüsse voraussetzen und ein gleiches Maß an Bildung somit Unter- bzw. Überqualifikation produzieren würde. Weder die Befähigung zur alltäglichen Lebensführung und die Anpassung an die Erfordernisse der unmittelbaren Lebenswelt noch die gesellschaftliche sowie politische Partizipation stehen bei dieser Definition von Bildungserfolg im Vordergrund, sondern die Erlangung von Berufsqualifikation und eines entsprechenden Status, was bedeutet, dass Bildungserfolg anhand der Vermittlung und Überprüfung schulischer Bildung in Form von Noten, Zertifikaten und dem Zugang zu höherer Bildung sowie letztlich dem daraus resultierenden beruflichen Erfolg gemessen wird. Hierbei handelt es sich um eine Messung anhand objektiver Kriterien, die sowohl die Akteursperspektive als auch milieuspezifische Differenzen unberücksichtigt lässt.
Bildungserfolg ist demzufolge nicht gleich Bildungserfolg, und Bildungserfolg im einen Sinne muss nun nicht mit Bildungserfolg in einem anderen Sinne einhergehen, vielmehr eröffnen sich erhebliche Konfliktdimensionen. Wer durch spezifische Milieubedingungen geprägt und innerhalb dieser alltäglichen Lebensbedingungen sozialisiert wurde, in diesem Sinne also Bildungserfolge aufweisen kann, die ihn zur Gestaltung des täglichen Lebens befähigen, ist dadurch nicht gleichsam prädestiniert für schulische Bildungserfolge, weil die jeweiligen Definitionen von Bildungserfolg sich diametral widersprechen können – ist beispielsweise im Rahmen der alltäglichen Praxen eine Konzentration auf handwerkliche Tätigkeiten oder konkrete Problemlösungsstrategien nötig, negiert die Schule kurzerhand durch ihren Fokus auf abstrakte Bildung diese milieuspezifischen Bildungserfolge und stellt ihnen eine ganz eigene Definition derselben gegenüber, die mit den Milieubedingungen nicht oder nur bedingt kompatibel ist. Es stehen sich in Folge zwei Auffassungen von Bildungserfolg gegenüber, die nur schwer miteinander in Einklang zu bringen sind, nicht zuletzt, weil sie im außerschulischen Leben für den jeweiligen Akteur ganz unterschiedliche Relevanz aufweisen können, bis hin zur völligen lebensweltlichen Irrelevanz schulischer Bildungsprozesse.
[1] Bei der hier vollzogenen Trennung in formale, non-formale und informelle Bildung handelt es sich vorrangig um eine Trennung analytischer Natur, da sich die Bildungsformen in der alltäglichen Praxis durchaus überschneiden und deren Grenzen verschwimmen können (vgl. Abbildung), so z.B. bei Gesprächen, beim Spielen oder anderen Handlungen im schulischen Kontext, die zwar am Ort formaler Bildung stattfinden, allerdings nicht zu den formalen Lerninhalten zählen.
Literatur:
- Becker, R., & Hadjar, A. (2011). Meritokratie – Zur gesellschaftlichen Legitimation ungleicher Bildungs‑, Erwerbs- und Einkommenschancen in modernen Gesellschaften. In R. Becker (Hrsg.), Lehrbuch der Bildungssoziologie (2. Auflage) (S. 37–62). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bittlingmayer, U. H. (2006). Grundzüge einer mehrdimensionalen sozialstrukturellen Sozialisationsforschung. In M. Grundmann, D. Dravenau, U. H. Bittlingmayer, & W. Edelstein, Handlungsbefähigung und Milieu. Zur Analyse milieuspezifischer Alltagspraktiken und ihrer Ungleichheitsrelevanz (S. 37–55). Berlin: LIT Verlag.
- Bittlingmayer, U. H., & Grundmann, M. (2006). Die Schule als (Mit-)Erzeugerin des sozialen Raums. Zur Etablierung von Bildungsmilieus im Zuge rapider Modernisierung. Das Beispiel Island. In M. Grundmann, D. Dravenau, U. H. Bittlingmayer, & W. Edelstein, Handlungsbefähigung und Milieu. Zur Analyse milieuspezifischer Alltagspraktiken und ihrer Ungleichheitsrelevanz (S. 75–95). Berlin: LIT Verlag.
- Bock, K. (2008). Einwürfe zum Bildungsbegriff. Fragen für die Kinder- und Jugendhilfeforschung. In H.-U. Otto, & T. Rauschenbach (Hrsg.), Die andere Seite der Bildung. Zum Verhältnis von formellen und informellen Bildungsprozessen (2. Auflage) (S. 91–105). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Büchner, P. (2003). Stichwort: Bildung und soziale Ungleichheit. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 6. Jahrg. (Heft 1/2003), S. 5–24.
- Butterwegge, C. (2010). Kinderarmut und Bildung. In G. Quenzel, & K. Hurrelmann (Hrsg.), Bildungsverlierer – Neue Ungleichheiten (S. 537–555). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Dahrendorf, R. (1966). Bildung ist Bürgerrecht : Plädoyer für eine aktive Bildungspolitik. Hamburg: Nannen.
- Dollase, R. (2007). Bildung im Kindergarten und Früheinschulung. Ein Fall von Ignoranz und Forschungsamnesie. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 21 (1), S. 5–10.
- Dravenau, D. (2006). Die Entwicklung milieuspezifischer Handlungsbefähigung. In M. Grundmann, D. Dravenau, U. H. Bittlingmayer, & W. Edelstein, Handlungsbefähigung und Milieu. Zur Analyse milieuspezifischer Alltagspraktiken und ihrer Ungleichheitsrelevanz (S. 191–235). Berlin: LIT Verlag.
- Dravenau, D., & Groh-Samberg, O. (2005). Bildungsbenachteiligung als Institutioneneffekt. Zur Verschränkung kultureller und institutioneller Diskriminierung. In P. A. Berger, & H. Kahlert (Hrsg.), Institutionalisierte Ungleichheiten. Wie das Bildungswesen Chancen blockiert (S. 103–129). Weinheim und München: Juventa.
- Grundmann, M. (2006). Milieuspezifische Handlungsbefähigung sozialisationstheoretisch beleuchtet. In M. Grundmann, U. H. Bittlingmayer, D. Dravenau, & W. Edelstein, Handlungsbefähigung und Milieu. Zur Analyse milieuspezifischer Alltagspraktiken und ihrer Ungleichheitsrelevanz (S. 57–73). Berlin: LIT Verlag.
- Grundmann, M. (2011). Sozialisation – Erziehung – Bildung: Eine kritische Begriffsbestimmung. In R. Becker (Hrsg.), Lehrbuch der Bildungssoziologie (2. Auflage) (S. 63–85). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Grundmann, M., Bittlingmayer, U. H., Dravenau, D., & Edelstein, W. (2006). Bildungsstrukturen und sozialstrukturelle Sozialisation. In M. Grundmann, U. H. Bittlingmayer, D. Dravenau, & W. Edelstein, Handlungsbefähigung und Milieu. Zur Analyse milieuspezifischer Alltagspraktiken und ihrer Ungleichheitsrelevanz (S. 13–35). Berlin: LIT Verlag.
- Grundmann, M., Bittlingmayer, U., Dravenau, D., & Groh-Samberg, O. (2007). Bildung als Privileg und Fluch – zum Zusammenhang zwischen lebensweltlichen und institutionalisierten Bildungsprozessen. In R. Becker, & W. Lauterbach (Hrsg.), Bildung als Privileg (2. Auflage) (S. 43–70). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Grundmann, M., Groh-Samberg, O., Bittlingmayer, U. H., & Bauer, U. (2003). Milieuspezifische Bildungsstrategien in Familie und Gleichaltrigengruppe. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 6. Jahrg. (Heft 1/2003), S. 25–45.
- Huisken, F. (2005). Der »PISA-Schock« und seine Bewältigung. Hamburg: VSA-Verlag.
- Liebau, E. (2009). Der Störenfried. Warum Pädagogen Bourdieu nicht mögen. In B. Friebertshäuser, M. Rieger-Ladich, & L. Wigger (Hrsg.), Reflexive Erziehungswissenschaft (2. Auflage) (S. 41–58). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- OECD (Hrsg.). (2010). Bildung auf einen Blick 2010. Paris: OECD Publishing/W. Bertelsmann Verlag. Online verfügbar unter: http://dx.doi.org/10.1787/eag-2010-de (28.07.2012).
- Quenzel, G., & Hurrelmann, K. (2010). Bildungsverlierer: Neue soziale Ungleichheiten in der Wissensgesellschaft. In G. Quenzel, & K. Hurrelmann (Hrsg.), Bildungsverlierer – Neue Ungleichheiten (S. 11–33). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Rohlfs, C. (2011). Bildungseinstellungen. Schule und formale Bildung aus der Perspektive von Schülerinnen und Schülern. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Suderland, M. (2004). Territorien des Selbst. Frankfurt/M: Campus.
Natürlich kann ich hier arbeiten. Da arbeiten ja auch andere. Das sehe ich mit eignen Augen. Was ein andrer kann, das kann ich auch. Der Nachahmungstrieb des Menschen macht Helden und macht Sklaven. Wenn der nicht an den Peitschenhieben stirbt, dann werde ich sie wohl auch überleben können. […] Natürlich kann ich das auch. So geht der Krieg voran, und so fahren die Totenschiffe, alles nach dem selben Rezept. Die Menschen haben nur eine Schablone, nach der sie alles machen; das geht so glatt, daß sie ihr Hirn gar nicht anzustrengen brauchen, um ein andres Rezept auszudenken. Man geht nichts lieber als ausgetretene Pfade. Da fühlt man sich so schön sicher. Der Nachahmungstrieb ist schuld daran, daß die Menschheit innerhalb der letzten sechstausend Jahre keine wahren Fortschritte gemacht hat, sondern trotz Radio und Fliegerei in der selben Barbarei lebt wie am Anfang der europäischen Periode. So hat es der Vater gemacht, und so hat es der Sohn nachzumachen. Schluß. Was für mich, den Vater, gut genug war, wird für dich, du Rotznase, wohl erst recht gut genug sein. […] Allein das, was anders gemacht wurde als bisher, allein das, was unter Protest der Väter, Päpste, Heiligen und Verantwortlichen anders gedacht wurde, hat der Menschheit neue Ausblicke verschafft und ihr den Glauben gegeben, daß eines fernen Tages vielleicht doch ein Fortschreiten wird beobachtet werden können. Dieser ferne Tag wird in Sicht sein, sobald die Menschen nicht mehr an Institutionen glauben, nicht an Autoritäten und nicht an eine Religion, welchen Namen man ihr auch immer geben mag.
B. Traven – Das Totenschiff
Vor etwas mehr als einem halben Jahr habe ich im Beitrag »Die kommenden Tage« die sozialen Folgen der anhaltenden Krise sowie die aufkeimenden Proteste der Occupy- als auch anderer Bewegungen skizziert und versucht, deren weitere Entwicklung zu prognostizieren. Genannt wurden als Krisenphänomene der weitgehenden Abbau des Sozialstaats, erstarkender Nationalismus, zunehmende Verarmung, Prekarisierung und Entsolidarisierung, Personalisierung der Kritik, schleichende Entdemokratisierung sowie die Radikalisierung des Protests und der Protestbekämpfung. Leider haben sich sämtliche dargestellten Aspekte in der Zwischenzeit tatsächlich weiter verschärft, einige sogar schneller und gewaltiger, als ich ursprünglich gedacht hatte.
Im Folgenden daher eine fragmentarische Bestandsaufnahme, die sich auf den aktuellen Zustand Europas konzentriert, verbunden mit zahlreichen exemplarischen Links zu Artikeln und Informationen. Sie sollen als Überblick und Anhaltspunkte für weitergehende Recherchen dienen, damit sich jeder Leser anhand der Berichte selbst ein Bild machen kann und nicht auf meine Interpretation angewiesen ist.
Abbau des Sozialstaats
Die Sparmaßnahmen in Griechenland, Italien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Spanien, Portugal und anderen europäischen Ländern bedeuten nicht zuletzt einen Abbau des Sozialstaats. Sie umfassen quer durch Europa u.a. Maßnahmen wie Rentenkürzungen sowie die Anhebung des Rentenalters, die Lockerung des Kündigungsschutzes, Lohnkürzungen im öffentlichen Dienst, Einführung neuer Gebühren oder Gebührenerhöhungen, die Kürzung von Arbeitslosenunterstützung, Sozialgeld und ähnlichen Sozialleistungen. Die größten Einschnitte finden dabei in der Regel in den Bereichen Gesundheit und Bildung statt, wodurch nicht nur die gegenwärtige Versorgung und Ausbildung der Bevölkerung beschnitten wird, sondern auch deren individuelle sowie die gesamtgesellschaftliche Zukunftsperspektive. Entsprechend werden immer größere Teile der Bevölkerung in Armut und Verzweiflung gedrängt, die mitunter zum Suizid führt (so ist beispielsweise die Suizidrate in Griechenland in den letzten zwei Jahren um mehr als 40 Prozent angestiegen).
- Am Rande der Armut
Portugal hat harte Sparmaßnahmen beschlossen und weitere werden folgen. Die Bevölkerung protestiert. - Wenn Krankheit zum Luxus wird
In Portugal werden die Gebühren im Gesundheitswesen genauso deutlich angehoben wie viele Steuern. - Spaniens Regierung beschließt drastische Sparmaßnahmen
Spaniens Regierung will 27 Milliarden Euro sparen, um das Haushaltsdefizit zu senken. Der Finanzminister spricht vom härtesten Sparprogramm seit 30 Jahren. - Neue Armut in Spanien: Suppenküchen für den Mittelstand
Spaniens Wirtschaftsaussichten sind verheerend, das Vertrauen der Finanzmärkte schwindet. Nun strebt die Klasse der „neuen Armen“ verzweifelt nach Sichtbarkeit. - Spanien: Wieder 40 Schüler pro Klasse
Rund 100.000 Spanier demonstrieren landesweit gegen die Spar- und Kürzungsorgie der Regierung. Es scheint höchste Zeit zu sein. Weite Kreise der Bevölkerung drohen zu verarmen. - Suizidserie in Italien: Arroganz der Politik tötet
Eine Suizidserie erschüttert Italien. Liegt es an der Wirtschaftskrise? An der Regierung? Gar an der preußischen Pünktlichkeit bei der Steuerzahlung? - Italien: «Monti hat die Toten auf dem Gewissen»
Um Italien aus der Krise zu holen, setzt Monti auf rigoroses Sparen. Der Druck auf das Volk ist gross. Täglich berichten Medien über Selbstmorde aus Verzweiflung. Viele machen den Staatschef dafür verantwortlich. - 78jährige Italienerin springt nach Rentenkürzung in den Tod
In Sizilien hat sich eine 78jährige Frau wegen Geldmangels von 4. Stock eines Wohnhauses in den Tod gestürzt. Es ist nicht das erste Mal, dass in Italien jemand infolge der aktuellen Wirtschaftskrise Suizid begangen hat. Oft sind es ältere Personen. - Suizid eines Rentners löst Krawalle in Athen aus
Ein griechischer Rentner sah angesichts seiner Schulden keinen anderen Ausweg – und erschoss sich aus Verzweiflung. In Athen kam es daraufhin zu Ausschreitungen. Mehrere Menschen warfen Brandsätze auf Polizisten und gaben dem Staat die Schuld am Tod des Mannes. - Griechenland: Langsam breitet sich Angst aus
Man mag schon bald nicht mehr aus dem Haus gehen und mit irgendjemandem reden, denn überall schwebt nur ein und dieselbe Frage, zum Teil ausgesprochen, zum Teil in Gesichtern und Augen geschrieben: Wie wird das alles weitergehen? - Griechenland: „2012 werden wir den Zusammenbruch der Mittelschicht erleben“
- Griechenland: Eltern können ihre Kinder nicht mehr ernähren
Infolge der griechischen Wirtschaftskrise stehen viele Familien vor dem finanziellen Ruin. Erst ersuchten sie das Sozialamt für finanzielle Unterstützung – nun bitten sie um Obhut für ihre Kinder. Wohlfahrtsorganisationen warnen vor Bedingungen der dritten Welt. - Kanzlerin hält höhere Lebensarbeitszeit für nötig
Die Menschen werden nicht kürzer, sondern länger arbeiten müssen, sagt Kanzlerin Merkel auf dem Deutschen Seniorentag. Bundespräsident Gauck hatte dort zuvor für eine Flexibilisierung des Renteneintrittsalters plädiert.
Rezession
Vor allem die europäische Südperipherie, aber auch andere europäische Staaten leiden unter Rezession unterschiedlichen Ausmaßes, wenngleich einige Staaten bislang davon verschont geblieben sind. Die strikten Maßnahmen der Austeritätspolitik wiederum zementieren die Abwärtsspirale der entsprechenden Länder in immer tiefere Rezession, da Lohnkürzungen, Gebühren- und Steuererhöhungen wie z.B. bei der Mehrwertsteuer oder die Einführung neuer Sondersteuern zulasten der Unter- und Mittelschicht sich negativ auf den privaten Konsum und damit letztlich die Produktion und das Steueraufkommen auswirken. Auch hierzulande wird die Krise spürbarer, sodass mittelfristig Meldungen wie diese kein Einzelfall bleiben werden, zumal wirtschaftliche Abkühlung auf globaler Ebene – mit besonderem Blick auf China – zu beobachten ist. Hinzu kommen aufgrund immer aufwendigerer Fördermethoden stetig steigende Energiekosten.
- Griechenland: Industrieproduktion März 2012 mit ‑8,5% zum Vorjahresmonat
- Griechenland: ‑56,7% bei den PKW-Neuzulassungen April 2012
- Griechenland: Auftragseingang der Industrie im Februar 2012 mit ‑13,8% zum Vorjahresmonat
- Griechenland: reale Einzelhandelsumsätze weiter mit Dynamik abwärts
- Spanien: Industrieproduktion schrumpft mit ‑10,4%
- Spanien: Land unter bei den PKW-Neuzulassungen
- Spanien: reale Einzelhandelsumsätze auf dem Niveau von Mitte 1999
- Spanien auf Absturzkurs
Risikoaufschläge für Staatsanleihen steigen auf ein Rekordhoch wegen Zweifel an den Banken - Portugal: PKW-Neuzulassungen April 2012 mit ‑41,7%
- Portugal: PKW-Neuzulassungen im März 2012 mit ‑49,2%
- Portugal auf Griechenland-Kurs oder: die EU und der Eisberg
- Portugal erlebt „nie dagewesene Rezession“
Die Zentralbank des Landes korrigiert die Konjunkturprognose deutlich nach unten - Irland: PKW-Neuzulassungen April 2012 mit ‑22,0% und kumuliert in den PIIGS mit ‑21,7%
- Italien: schwächste PKW-Neuzulassungen in einem April seit 1990
- Italien: Moody’s stuft 26 italienische Banken herab
Moody’s begründete den Schritt in erster Linie mit der schlechten wirtschaftlichen Verfassung von Italien. Das Land sei in die Rezession zurückgefallen, erklärte die Ratingagentur. - Großbritannien rutscht in die Rezession
Der britische Premier David Cameron hat im Kampf gegen die Wirtschaftskrise einen Rückschlag erlitten. Großbritannien ist erstmals seit 2009 wieder in die Rezession gerutscht. Das Minus im ersten Quartal hat selbst Experten überrascht. - Briten sparen sich in Rezession
Großbritannien will sich aus der Krise sparen. Aber stattdessen verschärft sich die wirtschaftliche Situation auf der Insel. Das zweite Quartal in Folge schrumpft das Bruttoinlandsprodukt. Die Rezession ist da – und die Lage wird sich so schnell nicht bessern, sagen nicht nur Analysten. - Eurozone: Deutlicher Rückgang der Industrieproduktion
In der gesamten Eurozone ist die Industrieproduktion im März deutlich zurückgegangen, obwohl Ökonomen mit einem leichten Wachstum gerechnet hatten. Den größten Rückgang in Bezug auf den Vorjahresmonat wiesen Luxemburg und Griechenland auf. - Kurzarbeit bei Ford in Köln
Auch hierzulande wird die Krise spürbarer, sodass mittelfristig Meldungen wie diese kein Einzelfall bleiben werden. - Oil prices could double by 2022, IMF warned
Global trade would be profoundly affected if crude prices permanently doubled from current historic high of $113 a barrel - Peak Oil: Großbritanniens Ölförderung in 2011 um fast ein Sechstel gesunken
Großbritannien hat sein Ölfördermaximum 1999 überschritten. Seitdem sinken die Fördermengen. Angesichts der Benzinpreisdebatte lohnt ein Blick auf das schwindende Nordseeöl. - Peak Oil
Generelle Informationen und aktuelle Meldungen
Nationalismus & zunehmende Entsolidarisierung
Zusätzlich zur unverhohlenen und zum Teil auch von politischer Seite befeuerten Hetze gegen die vermeintlichen Krisenverursacher im europäischen Süden, für deren angebliche Faulheit und Inkompetenz man nicht länger Zahlmeister sein wolle, werden – allen voran durch Deutschland – nationale Wirtschaftsinteressen auf Kosten von Drittstaaten vorangetrieben. Das Projekt Europa, das die Bevölkerungen der europäischen Staaten einander näherbringen sollte, verkommt zum Gegenteil. Im Zuge der Krise ist nicht nur eine allgemeine Spaltung Europas zu beobachten, es ist zudem auch ein deutlicher Graben zwischen den strauchelnden europäischen Staaten und Deutschland entstanden, letzteres seinerseits hegemoniales Zentrum der Krisenpolitik und großer Profiteur des Euros sowie des wirtschaftlichen Ungleichgewichts in Europa.
Selbst noch in der momentanen Situation profitiert Deutschland zumindest kurzfristig aus den Krisenphänomenen, u.a. durch niedrige bis negative Zinsen für Anleihen oder etwa den schwachen Euro, der deutsche Exporte in Länder außerhalb der Eurozone verbilligt. Diese kurzfristigen Vorteile für die deutsche Wirtschaft, erkauft auf dem Rücken Europas, sollten bei deutschen Vorschlägen zur Krisenbekämpfung stets im Hinterkopf behalten werden, offenbaren sie doch einen gewichtigen Interessenkonflikt. Erfolgsmeldungen wie etwa steigender deutscher Export sind daher mit Vorsicht zu genießen, denn mittel- bis langfristig wird der Kelch auch an Deutschland nicht vorübergehen (vgl. Abschnitt Rezession), gerade angesichts der Exportlastigkeit der deutschen Wirtschaft.
Generell wird weiterhin mittels nationalistischer Argumentationslinien versucht, die von den Krisenentwicklungen am stärksten Betroffenen der jeweiligen Staaten gegeneinander auszuspielen. Nationalismus und Entsolidarisierung zeigen sich exemplarisch auch am deutschen Umgang mit Griechenland, dessen Bevölkerung kurz vor den Wahlen mehr oder weniger offen angedroht wurde, es müsse unabhängig des Wahlausgangs die an die finanziellen Hilfspakete geknüpften Bedingungen erfüllen oder ansonsten die Konsequenzen tragen. Mit Wolfgang Schäubles Ambitionen zur Führung der Eurogruppe könnten sich deutsche Vormachtsansprüche zusätzlich zementieren, die zuletzt mit der Wahl in Frankreich ins Wanken geraten waren.
Innerhalb der einzelnen Staaten sind andere Formen der Entsolidarisierung zu beobachten, nämlich verstärkte von oben nach unten gerichtete Abgrenzungsbemühungen bis hin zur Abwertung schwächerer sozialer Gruppen. Für Deutschland fasst der Soziologe Wilhelm Heitmeyer, Herausgeber der Studie »Deutsche Zustände«, exemplarisch zusammen:
Die laufenden Prozesse der Umverteilung und ihre gesellschaftliche Zerstörungskraft nehmen stetig zu und führen zu einer immer größer werdenden Spaltung der Gesellschaft. Die oberen Einkommensgruppen nehmen diese Spaltung nur begrenzt wahr, sie sind im Gegenteil der Meinung, dass sie zu wenig vom Wachstum profitieren. Sie sind rasch bereit, die Hilfe und Solidarität für schwache Gruppen aufzukündigen. Sie werten zunehmend stärker ab. Die Studie macht deutlich, es existiert eine geballte Wucht rabiater Eliten und die Transmission sozialer Kälte durch eine rohe Bürgerlichkeit, die sich selbst in der Opferrolle sieht und deshalb immer neue Abwertungen gegen schwache Gruppen in Szene setzt. Und die Studie zeigt, wie stark Menschen aufgrund von ethnischen, kulturellen oder religiösen Merkmalen, der sexuellen Orientierung, des Geschlechts, einer körperlichen Einschränkung oder aus sozialen Gründen mit solchen Mentalitäten konfrontiert und ihnen machtlos ausgeliefert sind. Die Opfergruppen sind mittlerweile wehrlos und nicht mobilisierungsfähig. Insgesamt ist eine ökonomische Durchdringung sozialer Verhältnisse empirisch belegbar. Sie geht Hand in Hand mit einem Anstieg von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Seit 2008 haben sich die krisenhaften Entwicklungen zeitlich massiv verdichtet.
Die Wahlergebnisse der rechten Parteien in Griechenland (zusammen knapp 17 % für die Parteien Chrysi Avgi und Unabhängige Griechen) und Frankreich (knapp 18 % für die Nationalisten unter Marine Le Pen) zeigen deutlich, welche Richtung derartige Abgrenzungs- und Entsolidarisierungstendenzen einschlagen können. Doch nicht nur kleine, rechtsradikale Parteien, sondern auch konservative Volksparteien betrieben kräftig Stimmungsmache gegen sozial Schwache und Migranten, wie die Wahlkämpfe in Frankreich und Griechenland vor Augen geführt haben. Zudem wird die restriktive EU-Migrationspolitik in Zeiten der Krise noch schärfer vorangetrieben, wie etwa massive Maßnahmen zur »Bekämpfung illegaler Migration« in Griechenland belegen.
- Griechenland: Markiert Immigranten dauerhaft!
Nea Dimokratia kämpft auch um die Wähler der im Wahlkampf stärker werdenden rechtsextremen und nationalistischen Partei Chryssi Avgi - Milizionäre bilden Bürger in Griechenland aus
In Griechenland werden Bürger von Mitgliedern rechtsradikaler Gruppierungen rekrutiert und mit dem Ziel ausgebildet, das Gesetz in die eigenen Hände zu nehmen. - Illegale Einwanderung wird zum reißerischen Wahlkampfthema
In Griechenland ist fast jeder Zehnte ein Migrant, Flüchtlinge sollen in Militärlagern eingesperrt werden, Razzien sind an der Tagesordnung, Rechte erhalten Aufwind. - Griechen-Frust mündet in Fremdenfeindlichkeit und Extremismus
- Griechenland: 30 new detention camps announced, for 30.000 immigrants!
- Griechenland: Panzergraben, Grenzzaun, Wachroboter und mehr deutsche Polizei
Griechenland wird auch in der Neubestimmung der EU-Migrationspolitik zum Testfall. Deutschland zwingt die Regierung in Athen zur rücksichtslosen Aufrüstung der Grenzüberwachung. - Sarkozy umgarnt rechten Rand
Frankreichs Präsident hofft bei der Stichwahl auf Stimmen der rechtsextremen „Front National“ von Marie Le Pen. Nicht allein: Auch sein Herausforderer François Hollande fischt am rechten Rand. - Rette sich, wer kann
Wilhelm Heitmeyer über »Deutsche Zustände«
Zunehmende Verarmung und Prekarisierung
Arbeitslosenzahlen wie zum Beispiel die Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland (~54 %), Spanien (~50 %) und Italien (~30 %) oder Statistiken der Einkommens- und Vermögensverteilung (erstere hier als interaktive Grafik für die USA), der Obdachlosigkeit, der Schuldenbelastung sowie der Armut oder des Armutsrisikos offenbaren allesamt anwachsende soziale Missstände (vgl. den Abschnitt zum Abbau des Sozialstaats). In vielen Ländern ist daher aufgrund der tristen Aussichten bereits von der »verlorenen Generation« die Rede. Ähnliches gilt für die USA, wo die Illusion einer moderaten Arbeitslosenquote nur durch statistische Spielereien aufrechterhalten werden kann.
- Italien: Arbeitslosigkeit steigt auf höchsten Stand seit 2004
Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab: In Italien ist die Arbeitslosigkeit im März auf den höchsten Stand seit über acht Jahren gestiegen. Auch in anderen EU-Ländern verschlechtert sich die Beschäftigungsquote. Insgesamt sind im Euro-Raum knapp 17,37 Millionen Menschen ohne Job. - Spanien: 24,44% Arbeitslosenquote in Q1 2012
- Hohe Arbeitslosigkeit schockt Spanien
Spanien weiter auf Talfahrt: Die Arbeitslosigkeit stieg im ersten Quartal auf 24,4 Prozent, mehr als die Hälfte der Jugendlichen ist arbeitslos – die Verkäufe im Einzelhandel fallen seit 21 Monaten. Die Banco Popular meldet einen Gewinneinbruch. - Spanien: Fast die Hälfte der Jugendlichen ohne Job
Spanische Gewerkschaften, Unternehmer und Regierung unterzeichnen Sozialpakt, während die Arbeitslosigkeit immer bedenklichere Höhen erklimmt - Spanien: „Krise gigantischen Ausmaßes“
Die extreme Arbeitslosigkeit steigt weiter stark und das Rating Spaniens nähert sich gefährlich der Ramsch-Grenze - Griechenland: Jugendarbeitslosigkeit steigt auf 53,8%
- More pain in Greece as unemployment hits record
- Europa: Skandalöse Jugendarbeitslosigkeit
- Europa: UN-Organisation warnt vor Folgen der Sparpolitik
Die Internationale Arbeitsorganisation hält die Sparmaßnahmen in Europa für verfehlt. Die Reformprogramme seien wenig durchdacht und hätten eine zerstörerische Wirkung. - USA: Not in Labor Force erneut mit Allzeithoch
Entdemokratisierung
Nicht nur wurden in Griechenland und Italien Übergangsregierungen gebildet, die von ungewählten Technokraten im Sinne der rigiden Sparpolitik angeführt werden, auch die teils panischen Reaktionen in Presse, Politik und an den Märkten auf den Linksruck der Wahlen in Frankreich und Griechenland sprechen eine deutliche, antidemokratische Sprache. Politische Prozesse werden zunehmend an antizipierten Marktreaktionen ausgerichtet, deren Verunsicherung so gut es geht vermieden wird; es findet eine Verschiebung der Souveränität statt, deren Ergebnis die »marktkonforme« (Angela Merkel) Demokratie ist. Mit dem geplanten Fiskalpakt wird zudem das Haushaltsrecht der Unterzeichnerstaaten starke Einschränkungen erfahren, was einer Schwächung parlamentarischer Kontrolle entspricht, sowie Entscheidungsgewalt u.a. zur EU-Kommission verlagert werden, die nicht demokratisch gewählt ist. Eine Befragung der Bevölkerung mittels Referendum wird, wie schon bei früheren Verträgen auf Ebene der EU, als Bedrohung betrachtet oder – wie in Griechenland geschehen – gar verhindert. Immer deutlicher tritt der unauflösbare Widerspruch zwischen Demokratie und Kapitalismus zutage. Mitbestimmung und friedlicher Protest (vgl. den folgenden Abschnitt), so scheint es, werden mit Verschärfung der Krise mehr und mehr zum Störfaktor für autoritäres Krisenmanagement und Märkte.
- Das Volk wird zum Störfaktor
Auf den Finanzmärkten geht ein Gespenst um: Was, wenn das Heer von Arbeitslosen und Armen die Politik der Mächtigen nicht mehr abnickt? Allzu viel Demokratie wollen deshalb weder Politiker noch Wirtschaftsbosse wagen. - Spanien will mit Sparprogramm die Märkte beruhigen
- EU-Regierungschefs wollen die Märkte beruhigen
- Griechenlands Politchaos verunsichert Anleger
Regierungschaos in Athen, wankende Banken in Madrid: Die Euro-Krise versetzt die Investoren an den Börsen in Angst und Schrecken. In ganz Europa fallen die Aktienkurse – in Griechenland sogar auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren. - Angst vor Euro-Crash: EU gibt harten Sparkurs für Griechenland auf
Die griechische Zeitung Real News berichtet, dass die Troika den Griechen signalisiert habe, auf die wichtigsten Punkte des Sparprogramms zu verzichten. (…) Im Gegenzug muss Griechenland sofort eine neue Regierung installieren – Neuwahlen sind ausdrücklich nicht erwünscht. - 10 Fragen und 10 Antworten zum Fiskalpakt
Radikalisierung des Protests und der Protestbekämpfung
Die Protestbewegung, ob sie sich nun gegen die aktuelle Krisenpolitik, Bankenspekulationen oder das gegenwärtige System als Ganzes richtet, hat zwar an Aufmerksamkeit von Seite der Massenmedien verloren, ist jedoch weiterhin sehr aktiv und kann sowohl große Demonstrationen als auch kleinere, alltäglichere Formen des Protests vorweisen, wie Besetzungen öffentlicher Plätze, kreative Spontankundgebungen, diverse Formen von Selbstorganisation und ‑versorgung, zivilen Ungehorsam, widerständische Alltagspraxen, Guerrilla Gardening und direkte Aktionen. In von der Krise stark betroffenen Ländern wie Griechenland oder Italien sind in diesem Kontext vermehrt Ausschreitungen zu beobachten.
Auf der anderen Seite werden Protestformen und deren Teilnehmer zunehmend kriminalisiert, Camps und Demonstrationen – teils gewaltsam – aufgelöst und non-konformes Verhalten bestraft. Italien erwägt sogar den Einsatz des Militärs. Generell scheint die Toleranzschwelle für Protest zu sinken, was zunehmend die Ausübung elementarer Freiheitsrechte beschneiden wird, um die Illusion des ungestörten Weiter-so aufrechtzuerhalten und Eigentumsverhältnisse als auch Geschäftsbetrieb zu verteidigen.
- Italiens Regierung berät über Einsatz von Armee
Erst das Attentat auf einen führenden Atommanager, dann wütende Proteste und Brandanschläge auf die Steuerbehörde: Italien wird von einer Welle der Gewalt erfasst. Die Regierung erwägt jetzt den Einsatz der Armee. - Italien: Monti-Regierung geht gewaltsam gegen Streiks vor
- Spanien: Aufruf zu Protesten im Internet soll als Bildung einer kriminellen Vereinigung bestraft werden
Spaniens rechte Regierung rüstet gegen Proteste auf und will mit drastischen Verschärfungen des Strafgesetzes für Ruhe sorgen, selbst passiver Widerstand soll als Angriff auf die Staatsgewalt geahndet werden. - Spanien: Wer Torten wirft, ist ein Terrorist
Gefährlich, gefährlich: Facebook und Twitter werden in Spanien zu kriminellen Vereinigungen. Wer aktiv gegen die Beschlüsse der Regierung angeht, wird kriminalisiert. - Occupy: Ruhig in Europa, blutig in den USA
Die Proteste von Occupy Wall Street zum 1. Mai sind in den USA von den Sicherheitskräften mit harter Hand begleitet worden. In Europa war die Lage eher ruhig. - Großbritannien: Hunderttausend streiken gegen Pensionsalter 67
- Deutschland: Stadt verbietet Blockupy-Proteste
Unter dem Motto „Blockupy“ wollten linke Gruppen Mitte Mai in Frankfurt aus Protest gegen die EU-Krisenpolitik Plätze besetzen. Die Stadt begründet ihr Verbot mit Erkenntnissen, wonach Aktivisten ein Gewalt-Training durchlaufen haben. Die Blockupy-Organisatoren wollen nun klagen. - Deutschland: Der Protest ist „unzumutbar“
Linke Gruppen rufen für Mitte Mai zu großen Blockadeaktionen im Frankfurter Bankenviertel auf. Die Stadt reagiert nun ihrerseits mit einem Demonstrationsverbot. - Deutschland: Verwaltungsgericht bestätigt Blockupy-Verbot
Das Frankfurter Verwaltungsgericht hält am Verbot der Blockupy-Aktionstage fest und erlaubt der Stadt, das Camp im Bankenviertel zu räumen – zum Schutz der öffentlichen Sicherheit. - Québec schränkt Versammlungsfreiheit ein
Die Regierung der kanadischen Provinz Québec hat auf andauernde Proteste gegen eine Erhöhung der Studiengebühren mit einem Notstandsgesetz reagiert. Darin wird die Versammlungsfreiheit stark beschnitten. - Grundrechte im Zeitalter der Krise
Die Behörden fahren eine harte Linie gegen Occupy, weil sie die Interessen der Geschäftswelt bedroht sehen. Die konservative Presse gibt dem Vorschub. - 12m15m – Aktionstage in Spanien
Zusammenfassung der spanischen Proteste vom 12. & 15. Mai 2012. - Spanien: Bilder der Räumung des friedlichen Protests vom 12.05.2012
Stellvertretend für ähnliche Räumungen in den USA und Europa. - Greece riots: Athens burns, police fire tear gas as violence flares up
Im weiteren Verlauf der Krise dürften derartige Bilder aus allen betroffenen Ländern häufiger zu sehen sein.
So weit der aktuelle Stand, ohne Anspruch auf Vollständigkeit – tatsächlich existieren europaweit und natürlich global aufgrund der anhaltenden Krise etliche weitere soziale, ökonomische und ökologische Problemlagen sowie entsprechende Proteste.
Es gibt keine konkreten Hinweise darauf, dass sich diese Zustände in absehbarer Zukunft verbessern werden. Das Gegenteil ist der Fall: Wird am bestehenden Kurs festgehalten, werden Arbeitslosigkeit und Sozialabbau weiter zunehmen, worauf der Lebensstandard der meisten Menschen in den betroffenen Ländern absinken wird, während verstärkt autoritäre Krisen- und Protestbewältigungsstrategien zu beobachten sein werden. Selbst an jenen, die bislang das gegenwärtige politische und ökonomische System verteidigt oder zumindest hingenommen haben, weil sie von dessen gewaltigen Schattenseiten nicht direkt betroffen waren, dürften die gegenwärtigen Entwicklungen nicht mehr lange unbemerkt vorübergehen. Die Einschläge kommen näher. Dies ist das Europa, in dem wir leben.
Langfristig werden diese Entwicklungen wohl vor keinem der so genannten Durchschnittsbürger Halt machen, da jeder zusätzliche Tag der bestehenden Verhältnisse die Zustände nur verschlimmert, auch wenn sie manche später erfassen werden als andere. Dieser tristen Aussicht steht die positive Vision gegenüber, die eigene Apathie und Ohnmacht angesichts scheinbar übermächtiger Strukturen zu überwinden, um aus der Krise konstruktive Kraft zu schöpfen und sich durch Protest, alternative Lebensweisen, Selbstorganisation oder ähnliche Maßnahmen aktiv an der Gestaltung einer gerechten, freien, demokratischen und solidarischen Gesellschaft zu beteiligen, in der wir gerne leben möchten. Niemand sollte darauf vertrauen, von der Politik Lösungen zu erhalten. Die Politik hat keine Lösungen und sie stellt die falschen Fragen. Es liegt an jedem einzelnen von uns, wie es weitergehen wird.
Sonstige weiterführende Links:
- Keep Talking Greece
Nachrichten aus Griechenland (Englisch) - Griechenland-Blog
Aus und über Griechenland – News, Meldungen, Kommentare - Ellas
Informationen darüber, wie das Leben in Griechenland in den Zeiten der „Krise“ wirklich aussieht – und ein bisschen mehr. - Spanienleben
Spanien: aktuelle Neuigkeiten aus Medien, Politik, Wirtschaft - Uhupardo
Aktuelle Berichte aus Spanien und über die Krisenpolitik im Allgemeinen
Es ist nur Widerstand, wenn dir Widerstand entgegenschlägt. Das klingt trivial und doch scheint es viele zu überfordern. Sie nennen sich Widerständler und – das ist das Tragische daran – sie fühlen sich auch so. Am Wochenende und nach Feierabend nehmen sie an Kundgebungen teil, verzichten dafür immerhin auf Party, Fernseher oder Shoppengehen, sie schreiben kritische Artikel, manche noch Leserbriefe, sie besuchen Kongresse und Diskussionsrunden, kurzum: Sie sagen ihre Meinung. Das halten sie für Widerstand, für radikal, manche gar für einen Umsturz des Systems, und das System lacht sich ins Fäustchen, weil es weiß, wie alles läuft: Eine Meinungsäußerung ist kein Widerstand, keine ernstzunehmende Provokation, vielmehr selbstverständlich oder wenigstens banal, und alles ist so herrlich relativ, dass jede Meinung recht hat, jeder Einwand wird umarmt und rasch osmotisch eingesaugt, kommt nie mehr raus, noch jeder Blödsinn wird als Blödsinn anerkannt. Jeder kritische Gedanke wird vereinnahmt. Die Welt ist schlecht, sagst du, und diese Welt sagt: Lass uns gemeinsam daran arbeiten, und schon bist du ein Kollaborateur.
Du kannst sagen, der Staat sei zum Kotzen, ein Monster und ein Menschenfeind, und wenn du schlechte Freunde hast, dann werden sie dich dafür auslachen, und wenn du etwas weniger schlechte Freunde hast, werden sie bloß mit ihren Köpfen nicken, und dem Staat ist es egal. Auf letzteres kommt es an. Die Staatsmacht hat kein Interesse an deiner persönlichen Privatmeinung, solange du noch höflich ihren Regeln folgst, denn darauf baut sie auf; sie schert sich nicht um deine Sympathie, so sicher ist ihr ihre Herrschaft. Das ist der so genannte Fortschritt gegenüber einem Unrechtsstaat, dem freie Meinung noch als Tücke gilt, weil er den Umstand nicht begriffen hat, wie manche Freiheit hier und da, großmütig gewährt, dem eigenen Bestehen hilft. Je länger die Leine, desto freier fühlt sich der Hund und hält sein Herrchen für den Heiland. Du kannst dir nun natürlich einbilden, du würdest Tag und Nacht verfolgt, kannst dich zum Helden verklären und einen Kämpfer nennen, kannst paranoid werden und dein Telefon nicht mehr benutzen, kannst hinter jedem nur noch Staatsmacht sehen, weil du glaubst, deine Meinung wäre irgendjemandem ein Dorn im Auge, doch die Wahrheit ist: Sie ist egal, so wie es deinen Chef nicht im geringsten schert, wie sehr du deine Arbeit auch verfluchen magst, solange du bloß jeden Morgen pünktlich bist.
Meinungsäußerung alleine ist kein Widerstand. Du kannst auf Demos gehen und deine Meinung kundtun, du kannst ganz schrecklich radikal ins Internet schreiben oder Flugzettel verteilen und damit Leute überzeugen, die schon längst überzeugt sind, oder ganz anderen Leuten deine Texte in die Hand drücken, die noch nicht überzeugt sind und die sich denken: Ach! Die dann nach Hause gehen und ihr Leben weiterleben wie bisher, weil es sie einen Scheiß interessiert, welche Fakten du ihnen ins Gesicht wirfst, denn sie haben schon ihre Meinung und die ist stärker als jeder Fakt. Es ist ein bildungsbürgerliches Märchen, man könne andere mit Fakten überzeugen. Spart euch eure Flyer, sie sind nur Umweltverschmutzung. Es geht nicht um Fakten und Argumente und Rationalität. Das ging es nie. Ginge es um Fakten, hätten wir eine andere Welt, eine schönere, für alle; Rassismus wäre kein Problem, es gäbe keine Intoleranz, Kriege würden selten, Armut wäre abgeschafft, dafür überall Frieden, Freude, Eierkuchen.
Es geht nicht um Fakten, es geht ums Gefühl. Das ist der wahre Klassengegensatz bei uns: Auf der einen Seite die Klasse derer, die sich gut fühlen, selbst wenn es ihnen schlecht geht, die positiven Denker, die Verdränger, die Ignoranten, die Arschlöcher und Naiven, und auf der anderen Seite jene, die an der Welt verzweifeln, die sich schlecht fühlen, selbst wenn es ihnen gut zu gehen hat. Wer sich gut fühlt, der meidet jene, die sich schlecht fühlen, weil sie ihn anstecken könnten mit ihrer schlechten Laune, mit ihrem Weltschmerz und ihrer negativen Aura, diese Miesmacher, die alles ändern wollen, die den neuen Mittelklassewagen nicht als heiße Schleuder, sondern bloß als Umweltschande sehen, als lächerliches Statussymbol. Das will doch keiner hören! Du kannst dich wohlfühlen, selbst wenn es allen scheiße geht, und daran krankt die Welt. Dann lebst du lieber in deiner wunderbaren Schaumstoffumgebung, deiner Gummizelle mit Vollpension, anstatt dich dem Leben auszusetzen, wie es dort draußen wütet, denn wüten tut es, mehr als du dir denkst. Wen interessieren Fakten, wenn du ein gutes Leben führen kannst.
Nein, Meinungsäußerung alleine ist kein Widerstand. Die effektivste Art des Widerstands, die alle Herrschaftsformen überdauern wird, ist die Verweigerung, wenn du dich dem verwehrst, das Besitz von dir ergreifen und dein Denken und dein Tun bestimmen will. Schick deine Kinder nicht zur Schule, und man wird sie dir schleunigst entreißen oder dich wenigstens für deinen Trotz bestrafen, bis du Einsicht zeigst, so nennen sie die Kapitulation. Geh nicht arbeiten, und man wird dich einer Zwangsarbeit zuweisen, die man flüchtig rosa anmalt und als gut gemeinte Eingliederungsmaßnahme tarnt, selbst wenn einer gar nicht eingegliedert werden will, weil das Böse immer schöne Namen trägt und mit guten Absichten daherkommt, oder aber man wird dich triezen, bis du zerbrichst und resignierst und dir »freiwillig« eine Arbeit suchst, nur um der Erniedrigung zu entgehen – das gilt hier heute schon als Freiheit. Geh in den Supermarkt und nimm dir, was du brauchst, ohne zu bezahlen, und man wird dich dafür anklagen. Deine Meinung ist kein Widerstand, solange du brav bist, unterwürfig, fügsam, treu, solange du arbeiten gehst, wenn man es von dir verlangt, solange du zahlst, was die Kasse anzeigt, solange du folgst, wenn man dir befiehlt. Meinungsäußerung ist ein Ventil, das man dir zugesteht, damit du nicht zum Widerständler wirst, denn du darfst ja alles sagen, frei und unbeschwert, und jeder darf es toll finden oder dumm oder lächerlich oder gemein und es hat alles keine Konsequenz.
Du kannst nicht gegen etwas sein und dich dann doch daran beteiligen, nicht wenn du ehrlich mit dir sein willst. Verweigerst du aber, bist du ein Fall für Moralisten und Pädagogenpropaganda, Sozialarbeitskollaborateure oder Therapeutengaslighting, Politiker und sonstige Widerstandsbekämpfer. Nur in den seltensten Fällen steht dir ein Polizist mit Schild und Schlagstock gegenüber, die Macht hat viel subtilere Methoden. Du bist gestört, sagt der Therapeut, du bist ein Parasit, sagt der Politiker, du handelst unmoralisch, sagt der Prediger, du musst doch an die Zukunft denken, sagt deine Erziehung, und alle wollen sie dich wieder eingliedern in ihre Vorstellung von einem guten Leben und keiner begreift, warum du dich wehrst. Eingliederung, das ist der Punkt, und das Wort drückt es schon aus: Sei ein Glied in unserer Formation, marschiere mit, sei ständig frohen Mutes. Da stehen sie dann, studierte und kluge Leute, und fragen sich Beulen in den Kopf, wie sich einer gegen dieses tolle Leben auflehnen kann, dieses Leben in der Schaumstoffwelt, in der alles herrlich bunt ist, weich und wunderbar, man stößt nirgends an, solange man nur brav ist und gehorcht, sie kriegen das nicht in ihren Schädel rein. Sie haben studiert, um blöd zu werden, und dafür hat es sich gelohnt, sie sind konform, bestanden haben sie mit Bestnote.
Reine Meinungsäußerung ist kein Widerstand, niemand wird für seine Meinung an die Wand gestellt, keiner gefoltert, nicht hier, nicht heute, nicht wenn jede Meinung gleichgültig vorüberzieht, du bist nicht Hans und Sophie Scholl. Eine Meinungsäußerung ist bloß bequem, Schaumstoff um das tobende Gewissen. Äußere deine Meinung und beweise der Welt, vor allem aber beweise dir selbst: Ich habe meinen Unmut kundgetan, ich war nicht still. Es schläft sich ruhiger in der Nacht, nur ändern wird es freilich nichts.
Kritische Auseinandersetzung mit dem System und seiner Propaganda macht einsam. Denn in aller Regel zieht ja das soziale Umfeld (Kollegen, Familie, Freunde, Partner etc.) nicht mit, wenn einer anfängt, herrschende Ideologien in Frage zu stellen. Die Folgen reichen von Spott und Distanzierung bis hin zu sozialer Isolierung. Es muss einer schon ein gehöriges Maß an Autonomie und Kraft (im Sinne von Ichstärke) mitbringen, um sich von solchen Mechanismen nicht kleinkriegen zu lassen, d.h. sich diesem Gruppendruck nicht anzupassen und die aus einer kritischen Geisteshaltung notwendig resultierende Vereinsamung zu ertragen.
(Mrs. Mop in den Kommentaren dieses Beitrags)
4 minutes of Occupy Frankfurt
Wir leben in turbulenten Zeiten. Der Kapitalismus, wie wir ihn heute kennen, findet sein Ende – auf die eine oder auf die andere Art. Anstatt die Krise aber als Bedrohung und das Scheitern des Kapitalismus als Untergang der Welt wahrzunehmen, sind vielmehr die Chancen zu erkennen, die Grund zur Freude liefern, wenn sie genutzt werden.
Wer mit den immer deutlicher auftretenden Zerfallsprozessen des Kapitalismus das Ausbrechen eines globalen Chaos herannahen sieht, artikuliert mit diesen Bedrohungsszenarien Ängste, die vor allem eines offenbaren: Die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten und Anforderungen des bestehenden Wirtschaftssystems, dessen Sieg über die Sowjetunion aufgrund des daraus resultierenden Mangels an konkreten Systemalternativen bisweilen schon zur Mär vom Ende der Geschichte verleitet hat, haben sich bereits so sehr als Denkschemata in den Köpfen der Menschen festgesetzt, dass ein Wegfallen dieser Gesetzmäßigkeiten als Wegfall der Ordnung an sich begriffen wird, so als gäbe es keine anderen Möglichkeiten, das menschliche Miteinander zu organisieren, als jene, die zurzeit bestehen. Diese scheinbar alternativlosen gesellschaftlichen Strukturen, durch deren Selbstverständlichkeiten wir sozialisiert wurden und die daher in unsere Habitus, in unsere Handlungs- und Denkstrukturen Einzug gefunden haben, befinden sich nun in einer Krise, die nicht nur ökonomischer, sondern auch psychologischer Natur ist, denn die soziale Ordnung hat sich unserer bis in die Fantasie hinein bemächtigt, wo sie der Vorstellungskraft enge Grenzen setzt, die jenen des wirtschaftlichen Systems entsprechen. Eine grundlegende Änderung dieses Systems übersteigt selbst in dessen Krise noch die Grenzen des Vorstellbaren oder ist nur als Utopie denkbar, als etwas, dem per se keine (zeitnahe) Realisierungschance zugesprochen wird. Die Gedanken, habituell derart geprägt und folglich eingeschränkt, wirken somit als Komplizen des derzeitigen Systems fort und so muss die Krise der bestehenden Ordnung wie eine Krise der Ordnung an sich empfunden werden, der Zerfall des Kapitalismus wie der Zerfall jeglicher Gesellschaft.
Tatsächlich aber ist die derzeitige Krise eine Chance. Wer trotz aller Fakten noch unbeirrt darauf baut, es möge alles so bleiben, wie es ist, der möchte eine Gesellschaftsordnung am Leben erhalten, in der ein immer kleinerer Teil auf Kosten der großen Mehrheit lebt. Die sich ausbreitende Krise liefert die Möglichkeit, diesen Zustand zu ändern, im Kleinen wie im Großen. Genau dieses Anliegen vertreten die wachsenden weltweiten Proteste.
Nicht der Zusammenbruch stellt die Bedrohung dar, sondern jeder zusätzliche Tag, den das bestehende System künstlich am Leben erhalten wird – zu horrenden ökonomischen, ökologischen und sozialen Kosten. Wenn alles ungehemmt weiterläuft wie bisher, werden wir in naher Zukunft unter anderem Folgendes erleben:
- weitgehenden Abbau des Sozialstaats
der bereits vor Jahren eingesetzt hat und sich ständig verschärft, man schaue neben Deutschland nur auf die drakonischen Sparmaßnahmen in Griechenland, das jüngst verabschiedete Sparpaket Italiens, die drastischen Sparbemühungen in Frankreich, Großbritannien, Spanien und Portugal. - erstarkenden Nationalismus
der bereits jetzt schon zu beobachten ist, hierzulande am offensichtlichsten in Form der unverhohlenen und auch von politischer Seite – im Sinne nationaler Interessen – befeuerten Hetze gegen den vermeintlichen Krisenverursacher Griechenland, für dessen angebliche Faulheit und Inkompetenz man nicht länger Zahlmeister sein wolle, genauso wenig wie für andere Schuldenländer, während im Ausland teilweise Deutschland als Verursacher der Krise ausgemacht wird und entsprechend verhasst ist; der zudem durch die nationalen Wirtschaftsinteressen vorangetrieben wird, die allen voran Deutschland, aber auch Frankreich mit der Durchsetzung der eigenen Vorstellung von Krisenbewältigung und Haushaltspolitik auf Kosten dritter Länder verfolgt. - zunehmende Verarmung und Prekarisierung
die schon seit einiger Zeit zu verzeichnen ist, man führe sich bloß einmal Arbeitslosenzahlen wie zum Beispiel die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien (~45 %) und Italien (~30 %) oder Statistiken der Einkommens- und Vermögensverteilung (erstere hier als interaktive Grafik für die USA), der Obdachlosigkeit, der Schuldenbelastung sowie der Armut oder des Armutsrisikos zu Gemüte, die allesamt anwachsende soziale Missstände offenbaren. - grassierenden Sozialdarwinismus
der bereits heute vorzufinden ist, beispielsweise in Form der Diskriminierung von Arbeitslosen und Migranten, die – auch von politischer Seite – teilweise subtil, teilweise ganz offen als faul und dumm, als Parasiten oder als unfinanzierbare Last des Wirtschaftsstandorts diffamiert werden; der sich zudem hinter der breiten Akzeptanz von in den letzten Jahren wieder erstarkenden Geisteshaltungen wie „Nur wer arbeitet, soll auch essen“ mehr schlecht als recht verbirgt. - zunehmende Entsolidarisierung
die bereits in diesen Tagen exemplarisch als stetige Privatisierung, als einseitige Gebührenerhöhungen und Sparmaßnahmen zu Lasten unterer Schichten, als Abschottung der Wohlhabenden in Gated Communities und als das Ausspielen von Bevölkerungsteilen gegen andere Gruppen der Bevölkerung auszumachen ist, so zum Beispiel Geringverdiener gegen Arbeitslose oder „richtige Deutsche“ gegen Migranten. - Personalisierung der Kritik
die als aggressive Sündenbocksuche bereits heute deutlich zu vernehmen ist, wenn beispielsweise gezielt Banker und Spekulanten als Blutsauger oder Fremdkörper bezeichnet und teilweise sogar bedroht werden. - Entdemokratisierung
die momentan schon sehr eindringlich anhand von Griechenland und Italien zu beobachten ist, wo nun Technokraten im Sinne einer rigiden Sparpolitik die Übergangsregierungen leiten sollen, das jeweilige Land also de facto gar nicht mehr regiert, sondern bloß noch zur Abwicklung gemanaged werden wird; die außerdem auf europäischer Ebene klar zu verzeichnen ist, wo sich Entscheidungsprozesse unter Ausschluss europäischer Institutionen, die ihrerseits bereits unter Demokratiedefiziten leiden, mehr und mehr auf die deutsch-französische Doppelspitze konzentrieren; die zuletzt jedoch am deutlichsten an den offen demokratiefeindlichen Reaktionen auf die angekündigte Volksabstimmung in Griechenland abzulesen war. - Radikalisierung des Protests und der Protestbekämpfung
für die die Straßenschlachten in Athen, Rom und in den USA, aber auch die Riots in London ein Vorgeschmack waren.
All dies sind keine düsteren Zukunftsvisionen, sondern ausnahmslos Prozesse, die bereits eingesetzt haben und sich mit Zuspitzung der Krise proportional verschärfen werden, sofern ihnen nicht entgegengewirkt wird. Es ist der ganz normale Wahn, den die bestehende Krise zum Vorschein bringt.
Die globalen Proteste wiederum, die zurzeit stattfinden und immer mehr Zulauf erfahren, sind in ihrem Kern nicht unbedingt primär als Forderung zur Abschaffung des Kapitalismus zu begreifen – dies gelingt ihm aus eigener Kraft, wie immer offensichtlicher wird. Die Frage aber, die sich in der Krise und mit dem Zerfall der bestehenden Wirtschaftsordnung immer dringender stellt, lautet nun: In welche Richtung soll es weitergehen?
Folglich handelt es sich bei den Protesten – allen voran bei jenen der Indignados oder der Occupy-Bewegung sowie ihr verwandter Protestformen – um die Artikulation des Standpunkts, dass man sich dem Geschehen nicht in bestem Fatalismus hingeben möchte (der oft genug als Optimismus verkleidet wird), sondern stattdessen aktiv am Aufbau einer gerechteren Gesellschaft teilnehmen möchte oder diese zumindest einfordert. Frank Schirrmacher, dem man als Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung keine allzu große Linkslastigkeit vorwerfen oder zugutehalten kann, hat erst kürzlich den überaus befreienden Gedanken geäußert, dass wir uns zurzeit in einer sehr komfortablen Position befinden: Immer hat es geheißen, wir können uns dies nicht leisten oder jenes, weil das dem Wirtschaftsstandort schadet, weil das nicht finanzierbar ist, weil das in diesem Wirtschaftssystem nicht funktioniert und so weiter. Nun aber sind wir an einem Punkt, an dem offensichtlich wird, dass das Wirtschaftssystem an sich nicht funktioniert. Das heißt, wir können zum ersten Mal seit langer Zeit ungehemmt darüber nachdenken, wie wir gerne leben würden, ohne uns um die ökonomischen „Sachzwänge“ des Wirtschaftssystems scheren zu müssen, weil letzteres in seiner gegenwärtigen Form sowieso nicht funktioniert. Die Krise als Chance.
Wie eine andere Gesellschaft aussehen könnte, zeigt im Kleinen, quasi als Sozialexperiment, die Occupy-Bewegung: Menschen, denen von Politik und Wirtschaft immer wieder weisgemacht wird, sie seien auf sich allein gestellt im Kampf aller gegen alle, jeder sei nur für sich selbst verantwortlich und Solidarität ein nicht finanzierbarer Luxus, leben in Form dieser Bewegung das Gegenteil vor, helfen sich gegenseitig, versorgen sich gegenseitig, unterstützen sich gegenseitig. Sie mögen keine einheitlichen Ziele formulieren, keine ausgearbeiteten Konzepte und Patentlösungen anbieten, die einzufordern sowieso bloß illusorisch ist, doch es eint sie ein Unbehagen gegenüber den herrschenden Verhältnissen; sie lehnen ab, was die derzeitige Gesellschaft ihnen nahe- oder auferlegt, sie sagen zum Bestehenden: Fuck this shit! Die Occupy-Bewegung wagt den Versuch einer Gegenkultur und zeigt, dass ein anderes Leben möglich ist, eine andere Kultur mit anderen Werten, Prioritäten und Verhältnissen.
Jener Aspekt der gegenwärtigen Bewegung ist es folglich auch, der für die bestehende Ordnung die größte Zumutung darstellt – aus deren Sichtweise gesprochen. Während fragmentierte Proteste und Demonstrationen schon immer vorzufinden waren und entsprechend marginalisiert werden konnten, verfügt das Etablieren einer konstruktiven Gegenkultur, die weltweit große mediale Aufmerksamkeit erfährt und die sich international vernetzt als auch rasch ausgebreitet hat, über eine gänzlich andere Qualität, weil deren zugrundeliegende Idee das Potential besitzt, mehr und mehr Menschen zum Überdenken des Selbstverständlichen bewegen zu können, indem sie konkrete Alternativen zum Bestehenden aufzeigt, wenn auch bloß als soziales Experiment. Buckminster Fuller hat es wie folgt ausgedrückt: »You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.«
Letztlich gilt es also, die eigene Angst vor dem Kollaps, die eigene Ignoranz, die eigene Apathie und Ohnmacht angesichts scheinbar übermächtiger Strukturen zu überwinden, um aus der Krise konstruktive Kraft zu schöpfen. Kraft für eine bessere, gerechtere, glücklichere Gesellschaft, in der wir gerne leben möchten. Niemand sollte darauf vertrauen, von der Politik Lösungen zu erhalten. Die Politik hat keine Lösungen und sie stellt die falschen Fragen. Es liegt an jedem einzelnen von uns, wie es weitergehen wird.
Update vom 15.05.2012:
Die kommenden Tage (Teil 2) – eine Bestandsaufnahme sechs Monate nach Veröffentlichung dieses Artikels.
Der blaue Brief starrte mich an. Nein, Quatsch, ich starrte den blauen Brief an. Der blaue Brief lag einfach nur da. Briefe konnten nicht starren. Gegenstände konnten überhaupt keine menschlichen Handlungen vollziehen. Vielerlei drittklassige Schriftsteller versuchten Dinge zu vermenschlichen, ließen sie starren, fühlen, rufen, staunen. Meist handelte es sich dabei um Menschen, die das Schreiben als Beruf bezeichneten. Wer aber das Schreiben als Beruf verunglimpfte, im Schreiben folglich eine Art von institutionalisierter Arbeit sah, die ja in der Regel mit allerhand nervtötenden Terminen, ständiger Plackerei und dem maßgeblichen Ziel der finanziellen Absicherung verbunden war, der hatte seine Liebe zum geschriebenen Wort schon lange hinter sich gelassen. Um diesen Umstand zu verbergen, bediente er sich zahlreicher Kniffe wie jenem der Vermenschlichung. Der Leser sollte wissen: Hier ist ein Kreativer am Werk, ein Poet und Genie, das toten Dingen Leben einhauchen kann. Aber tote Dinge waren tot. Wären sie lebendig gewesen, hätte man sie Lebewesen genannt. Gegenstände konnten herumliegen, fallen, rollen, brennen, stinken, also einfach nur da sein, ihre Funktion erfüllen oder Schwerkraft und anderen äußeren Einflüssen gehorchen. Was sie nicht konnten, war starren. Wieso aber hatte ich das für einen Moment gedacht? Ich vertrieb diesen lausigen Gedanken aus meinem Kopf, machte schlechte Romane für meinen Fauxpas verantwortlich und starrte weiter auf Brief.
Aus der Küche holte ich mir ein Messer, schnitt einen Apfel in mundgerechte Stücke und setzte mich essend an den Tisch. Als der blaue Brief sich auch nach zwei Minuten noch nicht gerührt hatte, war ich mir sicher, es handelte sich dabei um einen Gegenstand wie jeden anderen, soll heißen: einen leblosen. Es befand sich keine Briefmarke auf dem Umschlag, was bedeutete, jemand hatte sich die Mühe gemacht, bis zu mir aufs Land hinaus zu fahren, nur um das Ding dann diskret im Briefkasten zu versenken, anstatt nach all dem Aufwand einfach an der Tür zu klingeln. Wäre da die Post nicht sinnvoller gewesen, fragte ich mich. Andererseits erforderte die Briefbeförderung per Post gewaltige finanzielle Mittel auf Seiten des Absenders, weshalb sich dieser vermutlich gedacht hatte, es wäre doch sehr viel klüger, flink ins eigene Auto zu steigen, ein Dutzend Kilometer mit einem Brief auf dem Beifahrersitz durch die Landschaft zu gondeln, schön viel Scheiße in die Luft zu blasen und den Brief ganz einfach persönlich bei mir einzuwerfen, anstatt es Menschen zu überlassen, die das hauptberuflich ausübten, sowohl das Briefetransportieren als auch das Scheiße-in-die-Luft-Blasen. Das kam dabei heraus, wenn Menschen das Recht auf Mobilität mit einem Anspruch auf Umweltverschmutzung verwechselten und Freiheit mit der Pflicht, von einem Termin zum nächsten zu düsen, zum Beispiel von der Arbeit zur Kneipe und später angetrunken ins heimische Bett.
Vom Stichwort ›angetrunken‹ inspiriert, vollzogen meine Gedanken einen Sprung zu einer naheliegenden Frage: Wieso war der Brief eigentlich blau? Ich wusste, dass es hieß, Schulen würden blaue Briefe verschicken, zumal ich während meiner Schulzeit so manchen Brief von meiner Schule erhalten hatte, sogar mit Briefmarken darauf, doch blau war keiner davon gewesen. Was blieb mir anderes übrig als ihn zu öffnen, um die Neugier zu befriedigen. Im Briefumschlag erwartete mich eine unpersönliche Einladung:
Liebe Freundinnen und Freunde,
zehn Jahre sind vergangen, seit wir von der Schulbank ins wahre Leben gezogen sind. Herzlich laden wir euch zum gemeinsamen Wiedersehen ein.
Unterhalb des Textes waren Zeitpunkt, Ort und Anfahrtsweg vermerkt, während auf der Rückseite der Einladung eine lachenden Schildkröte abgebildet war, die ein Zeugnis in der Hand hielt, was mir als Ausdruck schulischer Leistung irgendwie unangemessen schien, aber genau deswegen fast schon sympathisch wirkte, geradezu subversiv. Wahrscheinlicher jedoch war, dass der Urheber keinerlei subversive Ambitionen hegte, sondern das Bildchen einfach nur für lustig befunden hatte. Manches änderte sich eben selbst in zehn Jahren nicht, zum Beispiel schrecklicher Humor.
Es gab vieles, das Leid und Elend über die Menschheit brachte, wo immer es auftrat: Krieg, Missgunst, Gier, Eifersucht, Naturkatastrophen und eben Klassen- oder Jahrgangstreffen. Bis jetzt war ich von alldem verschont geblieben, aber jemand unternahm den Versuch, das zu ändern. Jemand, der mich unilateral als einen Freund bezeichnete, was das Konzept der Freundschaft ad absurdum führte bis verhöhnte. Jemand, der die dummdreiste Vorstellung kultivierte, nach der Schule würde man ins ›wahre Leben‹ ziehen, während die meisten doch tatsächlich bloß in Ehe, Fabrik oder Büro umgezogen waren.
Ein Klassen- oder Jahrgangstreffen war eine Veranstaltung, bei der sich die Banalität des Bösen unbarmherzig offenbarte. Menschen kamen zusammen, die sich seit ihrer gemeinsamen Internierung in einer Lehranstalt nicht mehr gesehen, geschweige denn miteinander gesprochen hatten. Mit einigen war man befreundet geblieben, als man den Schulabschluss endlich in der Tasche gehabt hatte, doch beim Großteil schätzte man sich froh, ihn endlich los zu sein. Das Jubiläumstreffen nun war ein erzwungener Prozess, der dazu führte, diese natürlich gewachsene Distanz mit einer synthetischen Nähe zu überwinden, um eine Grundstimmung des gegenseitigen Wettbewerbs zu provozieren. Der Ablauf eines solchen Zusammentreffens war sozial streng geregelt und ähnelte jenem Kartenspiel, bei dem die Spieler beispielsweise Hubraum, Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung oder Zylinderzahl der Fahrzeuge auf ihren Spielkarten miteinander verglichen, wobei der beste Wert gewann. Gespielt wurde es bei einem Klassen- oder Jahrgangstreffen allerdings nicht mit technischen Daten, sondern mit persönlichem Erfolg, beruflicher Leistung, Schönheit des Ehepartners, Lage des Hauses, Preis des PKW, Zensuren der Kinder, Exklusivität des Urlaubsziels, Ausübung von Macht und anderen erbärmlichen Statussymbolen der jeweiligen Mitspieler. Ich war arbeitslos und unverheiratet, besaß weder Auto noch Eigenheim und war demzufolge alles, was man nicht sein wollte, wenn man zu einem Klassentreffen ging.
Trotz meiner Abneigung gegen dieses kleinkarierte Spiel und der offensichtlichen Zumutungen einer solchen Veranstaltung nahm ich mir vor, der Einladung zu folgen. Wie eine Art Kriegsberichterstatter wollte ich das entsetzliche Elend begutachten, allerdings mit der nicht zu unterschätzenden Differenz, dass ich im Gegensatz zum unbeteiligten Beobachter auch in Nahkämpfe verwickelt sein würde und aktiv ins Kampfgeschehen eingreifen müsste. Das jedoch war ich gewohnt.
Noch am Abend desselben Tages rief ich jene Freunde an, die ich von der Schulzeit ins ›wahre Leben‹ mitgenommen hatte. Ich erkundigte mich, ob sie die Einladung ebenfalls erhalten hatten und was sie von ihr hielten. Anschließend erzählte ich ihnen von meinem Vorhaben und fragte nach, ob sie die Absicht hätten, der Veranstaltung ihrerseits beizuwohnen. Sie lachten über diese Frage und wünschten mir Glück bei meiner Expedition. Deswegen waren sie meine Freunde.
Einige Wochen später war es so weit, an einem windigen Samstagabend. Die Veranstaltung fand in einer Villa nahe von Hamburg statt. Wir waren ein Abiturjahrgang, daher gehörte Distinktion anscheinend zwangsläufig dazu, die Sehnsucht nach standesgemäßer Inszenierung, diese Selbstverherrlichung als Elite. Als ich die Räumlichkeiten betrat, war das Geschehen schon in Gang. Zu meiner Erleichterung hatte man die Veranstaltung als eine Art offener Party konzipiert, ohne Sitzordnung und irgendwelche Ansprachen. Es gab ein Buffet mit Häppchen und Hauptspeisen sowie eine Bar mit einem leidlich motivierten Barkeeper, der unter anderem Sekt und schlechte Drinks servierte, sodass die Anwesenden sich in wechselnder Konstellation an Tischen niederlassen oder kollektiv herumstehen konnten, was sehr viel angenehmer war, als den gesamten Abend an einem großen Tisch gemeinsam eingepfercht zu sein.
Ein wenig verloren blickte ich mich um, bis ich Chris sah. Eigentlich hieß er Christian. Zu Schulzeiten war er ein Punk gewesen, ein Rebell und Nonkonformist, der sich Autoritäten und Hierarchien nicht hatte beugen wollen und in der Schule, die sich ihren Häftlingen als Disziplinierung par excellence aufdrängte, folglich so seine Probleme gehabt hatte. Er war mir immer sympathisch gewesen, genau aus diesem Grund. Heute trug er einen verdammt gut sitzenden Anzug und etwas, das er früher als Spießerfrisur bezeichnet hätte. Innerlich musste ich lachen. Er ist eine Karikatur, dachte ich, er kommt hierher und hält allen den Spiegel vor, macht sich lustig über sie, betreibt Subversion. Das verdiente Respekt, daher ging ich zu ihm ans Buffet, wo er gerade das Angebot begutachtete.
»Mensch, Chris! Schickes Outfit«, grinste ich und nahm mir einen Teller.
»Danke«, erwiderte er mit einem Hauch von Überraschung.
»Nur für den Scheiß hier hast du dir so’n Ding besorgt?«
»Was? Wer bist du eigentlich?«
Zuerst lachte ich, doch dann wurde mir klar, dass er mich wirklich nicht erkannt hatte. Ich stellte mich ihm vor und wir plauderten eine Weile über die Schulzeit, die frühere Lehrer, unser Leben nach dem Abschluss und schließlich die berufliche Karriere. Ein Wort, für das er früher nur Verachtung übrig gehabt hatte. Nun war er derjenige, der es aussprach. Nach dem Abitur hatte er herumgelungert, ständig gekifft, viel gesoffen, was man halt so machte, wenn man alles andere zum Kotzen fand, was den Alkohol bisweilen einschloss. Doch irgendwann sei ihm die Erleuchtung gekommen, sagte er. Man dürfe ein Leben nicht so verschwenden, man müsse etwas aufbauen, etwas leisten. Ein Sozialarbeiter habe ihm geholfen, sich aus seiner Clique zu befreien, wie er es ausdrückte. Er hatte einen Job bekommen, wenig später auch eine eigene Wohnung. Von da an sei es nur noch aufwärts gegangen, er habe unglaublich hart gearbeitet, gespart, angelegt und investiert.
»Heute fehlt es mir an nichts«, schwärmte er mit hörbarem Stolz. »Ich krieg die Krise, wenn ich einen jammern höre, er findet keinen Job. Wer nicht faul ist, der findet auch was. Man muss sich halt zusammenreißen. Sieh mich an. Stattdessen wird jeder bestraft, der erfolgreich ist. Steuern hoch, Steuern hoch, das ist alles, was ich höre. Mit meinem Geld werden solche Faulpelze finanziert.«
»Sag mal, muss das nicht anstrengend sein?« hakte ich mit total beeindrucktem Gesichtsausdruck nach.
»Die Arbeit? Ja, schon, aber nur durch Leistung kommt man nach oben…«
»Neee, nicht die Arbeit. Jeden Tag die Ideale, die du mal hattest, kräftig in den Arsch zu ficken, nur für ein paar Scheinchen.«
Ich drehte mich um und führte einen inneren Kampf zugunsten der äußeren Contenance. Am liebsten hätte ich ihn ausgelacht, wäre das nicht der sichere Ruin für meinen Abgang gewesen.
Das sind die Schlimmsten, dachte ich und ließ meinen Blick durch den Raum schweifen, auf der Suche nach einem neuen Gesprächspartner. Diese Schlimmsten, das waren für mich soziale Aufsteiger, die von ihren Wurzeln nichts mehr wissen wollten. Weil sie selbst es ›geschafft‹ hatten, weil sie von der Frucht der Macht gekostet hatten, verteufelten sie alle, die es nicht taten. Ganz arme Würstchen waren das. Mit kleinen Würstchen vermutlich, weil solche Typen immer kleine Würstchen hatten und diesen Zustand irgendwie zu kompensieren trachteten, doch so genau wollte ich es nicht in Erfahrung bringen. Das Jahrgangstreffen fing an, mir Spaß zu machen. Ich kam in Fahrt, und das war gerade erst der Anfang.
Plötzlich wurde ich von der Seite angesprochen. Es war Torsten, der seinen Teller so berstend mit Speisen beladen hatte, wie man es sonst nur von deutschen Touristen aus dem Urlaub kannte, die die Angst umtrieb, bei einem zweiten Gang zum Buffet von der Zombieapokalypse heimgesucht zu werden, weshalb sie auf ihren Tellern gewagte Türme konstruierten, die allen Regeln der Statik zu widersprechen schienen. Im Gegensatz zu Chris hatte er mich umgehend erkannt und wir kamen ins Gespräch. Torsten war jemand, mit dem ich mich in der Schule gut verstanden hatte, obwohl ich ihn niemals als einen Freund betrachtet hätte. Er war das, was man klassisch einen Schulkameraden nannte. Nachdem wir die Eingangsfloskeln hinter uns gebracht hatten, erzählte er mir von seinem Job bei einer großen internationalen Werbeagentur.
»Das geile an dem Job ist, so viele unterschiedliche Kunden zu haben. Man hat ständig eine neue Herausforderung, dauernd eine komplett neue Arbeit mit komplett neuen Ideen. Ich kann mich kreativ ganz ausleben und verdiene dabei auch noch ordentlich.«
»Hm«, gab ich den nachdenklich Interessierten. »Was für Kunden hast du da so? Gibt’s da auch welche, bei denen du sagst: Das mach ich nicht, die mag ich nicht?«
»Klar gibt’s die! Ich arbeite nicht für Rüstungskonzerne, da hab ich ganz deutlich eine Linie gezogen.« Mit dem Finger zog er ganz deutlich eine Linie in die Luft. »Man will ja auch noch mit gutem Gewissen einschlafen können.«
Rüstungskonzerne taten mir Leid. Kein einziger Werber dieser Welt wollte freiwillig für sie arbeiten. Alle sagten sie: Nein, das kann ich ethisch nicht verantworten. Das musste der erste Satz gewesen sein, den sie auf der Werbekasperschule gelernt hatten und seitdem wie ein Mantra vor sich herbeteten. Zum Glück besaßen Rüstungskonzerne in der Regel Tochtergesellschaften oder eigenständige Divisionen, die sich mit ziviler Resteverwertung der militärischen Forschung beschäftigten und beispielsweise LKW statt Panzern herstellten, sodass man sich als Werber oder überhaupt als Angestellter gut damit herausreden konnte, mit der Produktion von dedizierten Tötungsinstrumenten nichts am Hut zu haben. Das war formal zwar zweifellos korrekt, aber spitzfindig, doch wenn es dem Selbstbetrug dienlich sein konnte, war freilich jedes Mittel erlaubt.
»Wow!« bewunderte ich seine ethische Standfestigkeit und erinnerte mich an die Arbeiten seiner Lügenbude. »Ich stelle mir das gerade vor. Da kommt so ein schmieriger Rüstungskonzern zu dir und sagt: Bitte erstellen Sie mir eine tolle Werbekampagne – und du, du sagst ganz konsequent: Nein! Am nächsten Tag stellt sich dann ein Energiekonzern bei dir vor, der zu den größten Umweltsündern des Landes gehört, und du verpasst ihm ein grünes Image. Das ist ethisch echt gleich viel besser.«
»Über diese Kampagne gab es intern eine rege Diskussion, auch ethisch. Wir haben uns dann am Ende für den Auftrag entschieden, weil der Konzern auch viel in grüne Energie investiert und…«
»Und weil das Geld so zahlreich floss, du schleimige Werbehure!« unterbrach ich ihn frech und nutzte seine sichtliche Überforderung, um noch ein wenig nachzulegen: »Einige Wochen später kriechst du einer Firma zu Kreuz, die ihre Mitarbeiter wie den letzten Dreck behandelt. Deine schöne Agentur aber kümmert sich darum, sie als sozial gerechtes Wohltätigkeitsparadies darzustellen. Ich meine, hey, du bist so konsequent mit deinen moralischen Grundsätzen, das ist echt beeindruckend! Mann, ich bin so froh, dass du nachts gut schlafen kannst, weil du nichts für Rüstungskonzerne machst.«
Da stand er und schaute wie ein Hund beim Kacken, der sich keiner Schuld bewusst war. Wenn es einen irdischen Zugang zur Hölle gab, dann lag er unterhalb dieses Gebäudes und hatte sich erst kürzlich aufgetan, um die hier anwesenden Geschöpfe auszuspeien. Er würde sie hoffentlich auch wieder zurücknehmen.
Gab es denn keine vernünftigen Menschen in diesem Haus? Zwei kleine Gruppen standen herum und waren untereinander jeweils in Diskussionen vertieft, soweit ich das beurteilen konnte. Ich überlegte, ob ich mich zu einem der beiden Grüppchen dazugesellen und mitdiskutieren sollte, war aber an der Umsetzung dieser Vorstellung nicht ernsthaft interessiert, weil ich seit jeher das Gespräch unter vier Augen bevorzugte. Dann sah ich Pia. Sie saß alleine an einem Tisch, vor sich ein Glas Sekt, an dem sie hin und wieder nippte. In der Schule war sie so etwas wie eine graue Maus und eher am unteren Ende der ausreichenden Notenskala beheimatet gewesen, was ich nicht tragisch fand, ihre Eltern damals allerdings umso mehr. Nun jedoch trug sie zwei ansehnliche Bildungsabschlüsse vor sich her, die sie für jede Beschäftigung qualifizierten. Außerdem hatte sie zu viel Make-up aufgetragen, doch war dies ein Phänomen, das ich an vielen Frauen beobachten konnte, die allem Anschein nach verinnerlicht hatten, was man ihnen fortwährend weismachen wollte. Jede beliebige Kosmetikwerbung suggerierte, Frauen seien von Natur aus hässliche Kreaturen, nicht im Ansatz begehrenswert, wenn sie sich nicht hinter Masken verbergen würden, an denen andere kräftig verdienten. Lieber trugen sie zu viel auf als gar nichts, aus Angst vor ihrem eigenen Gesicht. Einmal war ich verliebt an meine damalige Freundin herangetreten mit den Worten: ›Du bist am schönsten, wenn du ungeschminkt bist‹. Da hatte sie gelacht und mir kein Wort geglaubt.
Pia sah nicht so aus, als wäre ihr zum Lachen zumute. Nervös durchstreifte sie mit ihren Blicken den Raum und schien nach jemandem zu suchen. Sie war zu Schulzeiten immer sehr nett zu mir gewesen, vielleicht auch ein bisschen verknallt, darum ließ ich mich an ihrem Tisch nieder und begrüßte sie mit einigen freundlichen Worten. Wir kamen ins Gespräch. Eigentlich, so erzählte sie mir, war sie mit einer Freundin hergekommen, mit Kathrin, die sich jedoch auf der Suche nach einer Toilette im Obergeschoss verdrückt hatte, in verdächtiger zeitlicher Nähe zu Sebastian, was deren beider Abwesenheit durchaus erklärte. Sebastian war verheiratet, hatte diesen unglücklichen Umstand, wie es schien, gleichwohl temporär verdrängt, so wie man traumatischen Erlebnissen eben häufig den Zugang zum Bewusstsein verwehrte. Das war wissenschaftlich erwiesen, daher sollte niemand den Zeigefinger erheben und behaupten, der Betrug an seiner Frau sei Sebastians eigene Entscheidung, geschweige denn dessen Schuld gewesen.
Pia und ich jedenfalls machten uns darüber lustig wie gute Lästerschwestern. Nach einer Weile versuchte ich, das Gespräch in spannendere Gewässer zu navigieren, weil harmlose Lästereien zwar recht auflockernde Gesprächsinhalte darstellten, mich das gesamte Konzept des Lästerns aber doch sehr an Gartenzwerge und Blockwartmentalität erinnerte. Ein Themenkomplex, mit dem man jederzeit Freunde gewinnen konnte, ob nun im Supermarkt an der Kasse, in der Sauna oder auf dem Zahnarztstuhl, war das gern konferierte Feld der Politik. Ich sprach die um sich greifende Finanzkrise an, die bereits jetzt das Leben von Millionen Menschen zerstört hatte, obwohl sie gerade erst am Anfang stand. Ich belächelte die anhaltend herbeifantasierte Mär vom Aufschwung, der komischerweise bei niemandem so recht ankam. Ich erwähnte den Jubel um sinkende Arbeitslosenzahlen, die keiner, der noch ganz bei Trost war, für etwas anderes als Propaganda halten konnte. Die ganzen ekelhaften Nachrichten eben, während Pia bei allem still nickte.
»Mich kotzt das echt an, so verarscht zu werden«, rumorte es aus mir heraus. »Vergleich das mal mit dem Arabischen Frühling. Da gehen Menschen auf die Straße, weil sie demokratische Mitbestimmung fordern. Hierzulande schimpft man über die Schwerfälligkeit demokratischer Entscheidungsfindung und verteidigt allen Ernstes eingeschränkte Mitbestimmungsrechte, wo immer sie auftreten, weil Beschlüsse ja so viel effizienter gefällt werden könnten, wenn weniger Menschen daran beteiligt wären. Marktgerechte Demokratie nennen sie das und schielen mit einem Auge auf China. Da weiß man doch, was man von so einer Demokratie zu halten hat, oder?«
»Ach, weißt du, das interessiert mich alles nicht so recht. Man darf im Leben nur das Positive sehen, und das tue ich. Ich schaue keine Nachrichten mehr, weil mich das unglücklich macht.«
So also sahen Menschen aus, die Lebensratgeber lasen wie: ›Mit Yoga zum Glück‹, ›Lachen für ein gutes Leben‹, ›Dank Positivem Denken aus der Arbeitslosigkeit‹, ›Grinsen gegen Krebs‹. Oder schlimmer noch: die solchen Schund schrieben, um andere auszunehmen, die den Mist glaubten. Diese Menschen hatten keinen anderen Lebensinhalt vorzuweisen als alles wahnsinnig schön zu finden. Wenn es eines gab, das mich stärker ankotzte als verarscht zu werden, dann war es die Kraft der positiven Wahrnehmung, die Ignoranz auf Speed, die alle Probleme der Menschheit leichtfüßig lösen sollte. Hunger in der Dritten Welt? Man schlürfte Prosecco. Mord im Namen der Freiheit? Man sah sich einen lustigen Film an. Ölplattform geplatzt? Man gönnte sich mal was. Optimismus statt Vernunft, Apathie statt Zorn. Die Hölle, das war sie. Wer vorübergehend doch einmal aus dem Glückseligkeitsfaschismus purzelte, der schlug rasch in der Ratgeberliteratur nach, wie man angepasst zu leben hatte, anstatt einfach mal in sich hineinzuhorchen und auf den Tisch zu hauen.
»Würdest du das auch kleinen Kindern ins Gesicht sagen, die vor Hunger verrecken? ›Seht das Positive: Ihr müsst zum Abnehmen nicht joggen gehen‹? Oder zu Zwangsarbeitern im KZ? ›Seht das Positive: Jeder hier hat einen Arbeitsplatz‹? Menschen wie du kotzen mich an, weil sie mit ihrer optimistischen Ignoranz die ganze Scheiße auf der Welt erst ermöglichen.«
Mit ihrem am Boden hängenden Unterkiefer ließ ich sie zurück, bevor sie die Chance hatte, mir den Sekt ins Gesicht zu schütten. Ich kam mir vor wie eine Mutter, die ihrem Balg irgendwas verbieten oder es zum Aufessen bewegen wollte und zu diesem Zweck ganz schamlos die afrikanische Bevölkerung ins Spiel brachte, als hätte die es nicht schon schwer genug gehabt, selbst ohne europäische Scheißmütter. Glücklicherweise hatte ich mit meinem Nazivergleich noch auf die seriöse rhetorische Ebene zurückgefunden. Einerseits tat Pia mir leid, weil sie mir vormals wirklich sympathisch gewesen war; andererseits diente sie ja wirklich als Steigbügelhalter für das Böse auf diesem Planeten, zwar nicht sie allein, aber ihre Denkweise. Das sollte man Menschen auch klipp und klar mitteilen.
Von einer der herumstehenden Gruppen spaltete sich jemand ab und kam geradewegs auf mich zu. Es war Maike. Sie musste meine Unterhaltung mit Pia gesehen haben, die zugegebenermaßen etwas aus dem Ruder gelaufen war. Vorsorglich bereitete ich mich auf das Schlimmste vor. Maike aber kam zu mir herüber, legte einen Arm um meine Schulter und fing an, sich über Pia lustig zu machen.
»Ihr zwei habt euch ganz schön in die Haare gekriegt. Was war da los? Haben dir ihre neuen Titten nicht gefallen? Ganz schön billig so was. Was für ein Flittchen!«
Maike trug Schuhe mit Keilabsätzen, die bei jungen Frauen und solchen, die sich dafür hielten, schwer angesagt waren. Wenn ich ein solches Ungetüm an einem Frauenfuß entdeckte, war mein erster Eindruck jedes Mal, die arme Frau sei behindert und dass es sich um eine orthopädische Maßnahme handeln musste, die die Länge ihrer Beine künstlich ausgleichen sollte. Da der andere Fuß jedoch in der Regel mit einem entsprechenden Gegenstück ausgestattet war, präzisierte ich meine Diagnose gewöhnlich auf eine geistige Behinderung, die sich als so genanntes Modebewusstsein ausgab. Viele Frauen und Männer fielen ihr tagtäglich zum Opfer. Aus dieser Position heraus über die Ästhetik aufgepumpter Brüste zu urteilen, erschien mir gewagt.
»Ihre Brüste sind ihr kleinstes Problem«, sagte ich, was sehr viel lustiger gewesen wäre, hätte sie kleine Brüste gehabt. Der Alkohol in Maikes Blutbahn befand es trotzdem des Kicherns würdig. »Du wirst es nicht glauben, aber wir sind über Politik ins Streiten geraten.«
»Ha! Genau mein Metier. Kein Wunder, dass du da verzweifelt bist. Mit der kann man sich über so was nicht unterhalten. Die ist dafür halt zu dumm.«
Voller Stolz erklärte sie mir wortreich, für ein Nachrichtenmagazin bei einem großen Privatsender zu arbeiten und sich in dieser Funktion natürlich viel mit Politik zu beschäftigen, zumindest unter anderem. Das war der Knackpunkt: Unter anderem. Ihr Arbeitsplatz befand sich in der Redaktion eines dieser Lifestyle-Magazine, die am frühen Abend auf allen Privatsendern ausgestrahlt wurden und das Projekt der Aufklärung mit negativem Vorzeichen fortführten. Zu sehen gab es dort großartige Einspieler über stolpernde Politiker, was Maikes Interesse an politischen Prozessen erklärt und auch erschöpft haben dürfte, investigative Reportagen über neueste Modetrends aus Hollywood und wissenschaftliche Beiträge über wasserfestes Make-up, in denen willige Feuerwehrmänner geschminkten Frauen ins Gesicht spritzten, was in den Hirnen der Redaktionschefs für riesige Ständer und pubertäres Gekicher gesorgt haben dürfte. Dennoch gab es Frauen, die sich dazu erniedrigen ließen, so eine Sendung zu moderieren oder an deren Produktion willfährig teilzunehmen, worauf sie am Ende auch noch stolz waren. Die Emanzipation drehte sich im Grab herum, wenn sie solche Sendungen empfing, obwohl Gleichberechtigung ja auch bedeutete, genauso scheiße wie manch Mann sein zu dürfen.
»Wow!« sprach ich, worauf Maike mich eitel anlächelte. »Du arbeitest also für einen Verein, der sich tagelang mit den Höschen von Lady Gaga beschäftigen kann, aber für das Weltgeschehen keine Sendeminuten übrig hat; der Menschen unaufhörlich Luxusgüter präsentiert und sie wie Esel mit goldener Möhre vorm Maul zum ewigen Weiterackern motiviert; der sich über Randgruppen lustig macht, damit sich noch der letzte Idiot vor dem Fernseher so richtig gut fühlen kann?«
Zum Abschluss unserer Show stellte ich ihr die Eine-Million-Euro-Frage: »Wie kann man denn so weit sinken?«
Sie stieß ein empörtes ›Pöh!‹ aus, drehte sich um und zischte mit erhobenem Näschen davon. Einige Augenblicke später gesellte sie sich zu Torsten an einen Tisch. Sie tuschelten miteinander, als sie zu mir herübersahen. Ich hob mein Glas, zwinkerte ihnen fröhlich zu und stattete mein Gesicht mit einem wohlwollenden Lächeln aus, das sie verwirrte. Beide gaben vor, mich nicht gesehen zu haben, wandten mir ihre Rücken zu, schüttelten die Köpfe. Langsam wurde es heiß.
Von so viel Ekel erschüttert, suchte ich körperliche Erleichterung. Im gesamten Erdgeschoss konnte ich nur ein einziges Badezimmer entdecken, was ich für eine Villa dann doch recht schäbig fand. Noch schäbiger aber war, dass es von jemandem benutzt wurde. Vor der geschlossenen Tür stand Michael, der offensichtlich auch auf Einlass in das Heiligtum wartete. Seinen Kopf schmückte eine Gelfrisur, die irgendwie mit einer grau gerahmten Klugscheißerbrille eine Symbiose eingegangen war. Klugscheißerbrillen unterschieden sich von regulären Brillen dadurch, dass dem Träger in erster Linie nicht die funktionale Leistung am Herzen lag, also mit seinen Glubschern etwas von der Welt wahrnehmen zu können, sondern die Fremdwahrnehmung als gebildeter Bürger, als Mensch mit Durchblick, nicht physisch, sondern intellektuell. Dieser wiederum unterschied sich deutlich vom hippen Mitläufer, der eine Brille aus rein ästhetischen Gründen trug, bevorzugt im so genannten Vintage-Look, und diesen Schwachsinn auch noch mitgemacht hätte, wenn es angesagt gewesen wäre, Hörgeräte oder Krücken zu tragen.
Den gebührenden Respekt wahrend, der mit der Benutzung öffentlicher Bedürfnisanstalten allgemein einherging, stand ich untätig herum und begutachtete schweigend das aufregende Muster der Raufasertapete. Michael kannte keinen Respekt. Er sprach mich an. Nach kurzem Weißt-du-noch- und Na-wie-geht’s‑Geplänkel fing auch er an, letztere Frage mit langen Ausschweifungen über seine berufliche Tätigkeit zu beantworten. Warum bloß redeten so viele Menschen von ihrer Arbeit, von ihrem Studium, von ihrem Fitnessclub oder ihrem liebsten Fußballverein, wenn man sie fragte, wie es ihnen geht. Hatten sie kein eigenes Leben jenseits der Fremdbestimmung?
Michael jedenfalls erzählte mir, schon seit längerer Zeit für eine sehr bekannte Musikzeitschrift zu arbeiten, für den unglaublich kreativ benannten ›Lautsprecher‹.
»Die Atmosphäre in der Redaktion ist einfach toll«, himmelte er mir ungefragt vor. »Alle sind total jung, total locker. Jeder hat ganz viel Freiheit. Das ist für mich echt ein Traumjob. Die ganze Zeit darf ich Musik hören, darüber schreiben, sie bewerten, darf mich mit Künstlern treffen und Interviews führen, in die Szene eintauchen und neue Trends entdecken – oder welche setzen. Natürlich steckt da auch viel Arbeit drin, aber die ist es wert. Uns geht es einfach nur um gute Musik.«
Wer keinen Musikgeschmack aufweisen konnte, der las Musikzeitschriften, die ihren Lesern die lästige Aufgabe eigener Meinungsbildung gegen ein Entgelt bereitwillig abnahmen. Ähnliche Publikationen gab es für Literatur, Mode, Lyrik, Filme, Katzenbilder, Scheißhaufen und so ziemlich alles, was Menschen sonst noch hervorbrachten. Sie standen in bester Tradition jenes Menschentypus, der sich von Gott oder anderen Wahnvorstellungen dazu berufen fühlte, kulturelle Ausdrucksformen zu bewerten und dabei vorwiegend ›man‹ statt ›ich‹ zu gebrauchen, wie etwa: ›das hört man nicht‹, ›das liest man nicht‹, ›das sagt man nicht‹, ›das trägt man nicht‹. Diese hoheitlichen Verdikte fanden ihre treuen Abnehmer unter jenen, die sich durch Anschluss an bestehende Trends und Moden Individualität zu geben versuchten. Das Resultat war eine Armee von seelenlosen Zombies, die sich bei jedem Lied, bei jedem Film, bei jedem Kleidungsstück und jedem Buch erst einmal angestrengt den Kopf darüber zerbrachen, ob sie es denn überhaupt gut finden dürfen, und zur Klärung dieser Frage ihre heiligen Schriften konsultierten.
»Du sagst also anderen, was gute Musik ist und was nicht? Woher willst du das denn wissen? Bist du die Talentpolizei? Die Geschmacksgestapo? Ist dir klar, dass es da draußen unglaublich viele Menschen gibt, die irgendwelche Bands schlecht finden, bloß weil du sie schlecht findest? Die deine Texte lesen und deren Inhalt dann als eigene Meinung ausgeben? Macht dich das geil? Raffst du nicht, wie spießig das ist?«
»Bist du…«, wollte ich weiter ausholen, als die Tür des Badezimmers abrupt geöffnet wurde. Heraus kam René, während sich Michael dankbar darin verdrückte. René musste so sehr auf die Beherrschung seines besten Stücks fixiert gewesen sein, dass er die Unterhaltung vor der Badezimmertür gar nicht mitbekommen hatte. Anders konnte ich mir nicht erklären, wieso er stehenblieb und mir beschwingt die Hand gab, die er hoffentlich gewaschen hatte. Wie ich bald darauf erfuhr, war er Bankangestellter und lebte mit seiner Frau und zwei Kindern in der Frankfurter Innenstadt. Stolz zeigte er mir Fotos der beiden Töchter, garniert mit epischen Geschichten von Helenes wundervoller Einschulung und den großartigen Noten der fünf Jahre älteren Marie-Sophie. Mein Eindruck war, ich hatte einen Menschen vor mir, der ein Leben am Limit führte, weil er ohne Kompromisse eine konsequent selbstbestimmte Linie fuhr und seine abgedrehten Lebensträume erfüllt hatte, also Führerschein, Abitur, dann Wirtschaftsstudium und Reihenhaushälfte. Als er nach einer gefühlten Ewigkeit den Vorrat des familialen Erfolgs erschöpft hatte, den es zu erzählen lohnte, war es an mir, den eigenen Karrierepfad glamourös nachzuzeichnen.
»Und was machst du so? Ich hab gehört, bei dir lief es nicht so toll?«
»Ich bin arbeitslos«, erwiderte ich treuherzig.
»Oje. Ist das nicht schrecklich?«
Ich fand, das war eigentlich eine sehr gute Frage, wenn er sie nur nicht unbedingt mir gestellt hätte.
»Ich finde, das ist eigentlich eine sehr gute Frage«, antwortete ich der Wahrheit zuliebe. »Mal sehen. Du stehst jeden Morgen auf, damit du etliche Stunden hinter Panzerglas verbringen kannst, wo du den Gewinn deiner scheiß Bank vermehrst, von dem du aber nie etwas zu Gesicht bekommen wirst. Wenn du Glück hast, kannst du zwei Mal im Jahr in irgendeinen tollen Pauschalurlaub fahren oder Skilaufen gehen, aber sonst ist jeder Tag so langweilig wie der letzte. Ständig machst du dir die Hosen voll vor Angst, irgendwann mal deinen Job zu verlieren oder bei einem Überfall erschossen zu werden – was auch sein Gutes hätte, weil deiner Familie dann immerhin noch die Lebensversicherung zukommen würde. Ist das nicht schrecklich?«
Er ließ mich eiskalt stehen. Wenig später kam Michael aus dem Badezimmer und ging wortlos an mir vorbei. Ich fragte mich, ob er René und mich belauscht hatte. Was sonst konnte ihn so lange dort drin beschäftigt haben?
Beim Wasserlassen malte ich mir aus, dass draußen Möbel vor die Tür geschoben wurden, um die Party endlich von einem störenden Element zu befreien, das zufällig meinen Namen trug. Als ich schließlich die Tür öffnete, standen jedoch keine Möbel davor, sondern Hanna. Hanna arbeitete mittlerweile als Pflegerin in einer Psychiatrie, wie ich von Pia erfahren hatte. Sie war Betreuerin, Therapeutin, Psychologin, Psychotherapeutin, Psychopsychologin, Psychoanalytikerin, psychopathische Therapeutin oder was weiß ich, welcher Begriff gerade für Mechaniker des Innenlebens en vogue war, die sich in solchen Anstalten der emotionslosen Behandlung emotionaler Themen verschrieben hatten, der Behebung menschlicher Defekte, notfalls mithilfe der Chemie, damit der Motor weiterhin brummte. Um allen Klischees gerecht zu werden, trug sie eine rote Brille. Vielleicht ist sie beauftragt worden, mich nach den bisherigen Zusammenstößen mit dem Jahrgang in ihre Arbeitsstätte einzuweisen, mutmaßte ich.
Nichts dergleichen geschah. Sie nickte mir zu und sagte Hallo. Den bisherigen Verlauf des Abends noch einmal Revue passieren lassend, beschloss ich, das üblicherweise von meinen Gesprächspartnern bevorzugte Thema diesmal einfach vorwegzunehmen.
»Du bist jetzt in einer Psychiatrie, hab ich gehört.«
»Ja, schon.« Hanna lachte. »Aber als Ärztin, nicht als Patientin.«
Das war den Wachmannschaften solcher Einrichtungen wichtig. Klare Rollengrenzen mussten gezogen, eindeutige Hierarchien und eine unverrückbare Normalität als Bezugsrahmen konstruiert werden. Widersprach der Patient, war er verrückt. Gehorchte er, gestand er seine Verrücktheit. Hinein kamen Menschen mit einem Knacks, heraus kamen sie mit schweren Schäden. Wer dort arbeitete, war der eigentliche Irre, wurde aber nicht so genannt, denn er war es auf eine mit dem als ›normal‹ verkannten Wahnsinn sehr konform gehende Art und Weise.
»Ach, das ist ja verrückt«, kalauerte ich und luchste ihr ein Schmunzeln ab. »Was machst du da so?«
»Viel Verrücktes!« Zwei gleiche Wortwitze waren einer zu viel. »Aber im Ernst: Das ist echt super wichtige Arbeit. Mit was für Menschen man da zu tun hat, das ist der Wahnsinn.«
Sie hatte ihre Ausfahrt von der Wortspielautobahn verpasst. Gequält verrenkte ich meine Mundwinkel, um möglichst lebensnah ein Lächeln zu simulieren.
»Letzten Monat«, erzählte sie mir, »kam ein Mädchen zu uns, das wir vor dem Suizid gerettet haben. Die wollte sich umbringen, weil sie in der Schule nicht mehr mitkam. Ihre Versetzung war gefährdet, dann hätte sie ein Jahr wiederholen müssen. Die ganzen Freunde in der Klasse hätte sie natürlich auch verloren und gegenüber ihren Eltern schämte sie sich. Ihr war das alles zu viel. Ihre Eltern fanden sie in ihrem Zimmer. Tabletten.«
»Krass!« flüsterte ich nur.
»Das kannst du laut sagen. Na ja, aber die Hilfe kam ja noch rechtzeitig. Wir haben ihr dann geholfen, da durchzukommen. Sie hatte sich überfordert, wollte sich nicht eingestehen, dass sie die Stufe nicht schaffen würde, also konnte sie nur weitermachen, bis alles an die Wand fuhr. Ich hab dann mit ihr gesprochen, hab ihr klargemacht, dass es besser für sie ist, auf eine leichtere Schule zu wechseln, um den Druck ein wenig zu reduzieren. Da würde sie zwar auch ihre Freunde verlieren, aber eben nicht die Lust am Leben. Gott sei Dank hat sie das eingesehen. Am Ende war sie richtig glücklich, dass alles noch mal gut ausgegangen ist. Das sind so Momente, in denen ich weiß, das Richtige zu tun. Menschen zu helfen.«
Die Unterhaltung mit René schwirrte mir noch im Hinterkopf herum und so rief sie mir ins Bewusstsein, was ich Wichtiges von ihm gelernt hatte.
»Findest du das nicht schrecklich?« fragte ich sie mit treudoofem Blick.
»Natürlich ist das schrecklich!« antwortete sie mit dem gehobenen Selbstbewusstsein derjenigen, die sich auf der guten Seite wähnten. »Aber zum Glück ging es gut aus. Wir haben ja noch mal die Kurve gekriegt.«
»Neeee. Ich meinte, ob du nicht schrecklich findest, was du da machst.«
Sie stutzte.
»Da kommt ein Mädchen zu dir, das sich umbringen möchte, weil seine Schule ihm den Eindruck vermittelt, doof und unfähig zu sein, und anstelle daraus den einzigen empathischen Schluss zu ziehen, dass das ein verdammt beschissenes System sein muss, wenn es Kindern eine solche Erniedrigung zumutet, überzeugst du das arme Mädchen davon, auf eine leichtere Schule zu wechseln. Damit sagst du ihm doch ins Gesicht, dass es wirklich doof und unfähig ist! Du machst dich zum Handlanger von Strukturen, wegen der sie sich hat umbringen wollen – und du fühlst dich auch noch gut dabei! Findest du das nicht menschenverachtend? Was zum Teufel machst du an anderen Tagen? Vergewaltigungsopfern erklären, sie wären doch selbst schuld, wenn sie sich wie Schlampen anziehen?«
Sicherlich kannte Hanna unzählige Begriffe, die sie mir gerne um die Ohren gehauen hätte. ›Antisoziale Persönlichkeitsstörung‹ beispielsweise, weil ich es wagte, ihre pathologische Normalität in Frage zu stellen. Schule schwänzen galt ebenfalls als antisoziales Verhalten. Wenn aber einer begriff, so wie Chris das früher getan hatte, dass Schule und Gefängnis zahlreiche Parallelen aufwiesen und es nicht ums Lernen, sondern um die Einteilung in Hierarchiestufen ging, um Unterordnung und die Anpassung an ein bürgerliches Leben mit Ausbildung, Arbeit und Rente, dass daher nie das Wohl der Kinder im Vordergrund stand, sondern die ökonomische Verwertbarkeit menschlicher Ressourcen, dann war es in meinen Augen sehr gesund, sowohl geistig wie auch sozial, sich dieser Scheiße zu widersetzen, weil diese Strukturen das eigentliche Antisoziale darstellten. Leider hatte ich das erst am Ende meiner Schulzeit geschnallt.
Anstatt mit Fachterminologie um sich zu schmeißen, verpasste Hanna mir eine Ohrfeige und knallte ihr Sektglas auf den Boden, bevor sie in ihren Stiletto-Stiefeln davonklackerte. Von hinten gefiel sie mir.
Ich brauche schleunigst einen Drink, dachte ich, nachdem sie außer Hörweite gestöckelt war. Unschuld vortäuschend schlurfte ich zur Bar, an der sich bereits Andreas häuslich eingerichtet hatte.
»Was für ein langweiliger Haufen.« Er prostete mir zu. »Ich find’s toll, dass du hier ein wenig Stimmung reinbringst.«
»Einer muss es ja tun.«
Früher war Andreas ein typisches Kellerkind gewesen, Leistungskurse Mathe und Informatik, mit dem selbst noch auf dieser Party keiner so richtig zu tun haben wollte. Da er den ersten vernünftigen Satz des Abends von sich gegeben hatte, hielt ich ihn umgehend für einen netten Menschen. Vorurteile waren dazu da, sie zu überwinden. Wir tauschten unsere Eindrücke über die anwesende Langweilertruppe aus, deren Dünkelhaftigkeit und ihre Statussymbole. Mit spürbarem Ekel trug ich meinen vorläufigen Expeditionsbericht vor; legte Andreas die strikte Lebensplanung dar, die jeder der Mustermenschen hier offenbart hatte, mit dem ich ins Gespräch gekommen war. Andreas hatte dafür bloß einen einzigen Satz übrig: ›Je planmäßiger das eigene Leben funktioniert, desto weniger ist es ein eigenes Leben‹.
Mir fiel Diogenes ein, dieser griechische Philosoph, der angeblich in einer Tonne gehaust haben soll. Andreas verkörperte die modernisierte Version dieser Geschichte und hatte die Tonne gegen seinen Keller ausgetauscht. Vielleicht wäre die Welt eine bessere gewesen, hätte sie auf ihre Kellerkinder gehört.
Eine angesehene Karriere war Andreas im Gegensatz zu den vielen Leistungsmonstern auf dieser Party nicht sonderlich wichtig. Tagsüber arbeitete er als Softwareentwickler für einen großen deutschen Versicherungskonzern, betrieb in seiner Freizeit aber eine gesellschafts- und kapitalismuskritische Website, wie er mir euphorisch mitteilte. Er fand das alles scheiße, wie es lief, die ganze Gesellschaftsordnung war ihm ein Dorn im Auge.
»Ständig wird man verarscht«, seufzte er und rannte offene Türen bei mir ein. »Seit zehn Jahren sind wir im Krieg, nur keiner spricht das Wort offen aus. Oder die Finanzkrise! Unsere lachhafte Elite spielt sich als großer Europa-Retter auf. Dabei ist es doch Deutschland gewesen, das durch Lohndumping zum ach so tollen Exportweltmeister geworden ist und dadurch die Schulden der anderen Länder überhaupt erst nach oben getrieben hat. Nun wundert man sich hier, dass man im Ausland nicht als Held gefeiert wird. Als ob dich auf der Straße einer zusammenschlägt, dein ganzes Erspartes von dir fordert, damit er dir den Rettungswagen ruft, und für diese Wohltat dann auch noch gelobt werden möchte.«
Andreas schüttelte den Kopf und leerte sein Bier.
»Man soll härter arbeiten, heißt es, länger, besser, billiger«, fuhr er fort. »Man soll wählen gehen, obwohl sich ja doch nichts ändert. Man soll mit weniger Lohn, mit weniger Rente, mit weniger Urlaub zufrieden sein. Die Löhne seien gestiegen, schreiben die Zeitungen, dabei sind sie während der letzten Jahre um einiges gesunken, wenn man mal nachrechnet. Man soll schuften bis zum Umfallen und sich ein Leben lang weiterbilden. Man soll die Fresse halten, weil man sonst entlassen oder niedergeknüppelt wird. Man soll schön danke sagen für jede Zumutung, die einem auferlegt wird. Und die Schafe glauben den ganzen Mist.«
»Weil man sowieso nichts ändern kann«, vervollständigte ich ironisch.
»Genau! Genau das sagen sie dann: Da kann man nichts tun. Das ist halt so. Das ist schon immer so gewesen. Das wird auch immer so sein.«
»Weil sie zu blöd sind, Marktgesetze von Naturgesetzen zu unterscheiden.«
»Eben. Und weil sie immer noch glauben, die Ordnung käme von Gott. Heute sagen viele vielleicht nicht mehr ›Gott‹ dazu, aber was sie glauben, läuft auf das gleiche hinaus: Das ist halt so. Wie kleine Kinder. Obwohl, stimmt gar nicht – kleine Kinder stellen wesentlich mehr kritische Fragen als die meisten Erwachsenen. Wenn man ehrlich ist, muss man doch zugeben, die Aufklärung hat versagt. ›Habe Mut, dich deines eigenen Geldbeutels zu bedienen‹, das ist alles, was davon übrig geblieben ist.«
Ich fühlte mich wie ein Schatzsucher. Unter all dem charakterlosen Geröll, das in Abendgarderobe durch die Räumlichkeiten kullerte, hatte ich einen Edelstein entdeckt.
»Heute Mittag hab ich einen Artikel über kambodschanische Arbeitsverhältnisse geschrieben. Unter der Woche lässt mir der Job leider kaum Zeit.«
»Warum Kambodscha?« Ich konnte dem Themensprung nicht folgen.
»Weil unsere tollen Klamottenläden dort so gerne produzieren lassen. Kaufst du da manchmal ein? Bei diesen Ketten? Solltest du nicht. Die Menschen in den Fabriken dort brechen scharenweise zusammen und bekommen nur einen Hungerlohn dafür. Wer sich beschwert, wird rausgeschmissen.«
Davon hatte ich gelesen.
»Und das ist noch harmlos im Vergleich zur Elektronikbranche«, setzte er nach. »Hast du das mitbekommen von den Werken in China? Wo sich zahlreiche Mitarbeiter aus Protest vom Dach gestürzt haben? Jetzt hat die Firma dort überall Fangnetze installiert, um solche aufsehenerregenden Selbstmordversuche zu unterbinden. Das sind doch Problemlösungsstrategien nach der Logik von Psychopathen! Nur weil hier jeder unbedingt ein Smartphone in der Hand halten möchte…« Er schlug mit der Hand auf den Tresen. »Wenn ich solche Zustände sehe, werd ich echt wütend!«
»Ich auch.« Wir schwiegen uns für einige Sekunden an. »Aber weißt du, was mich am wütendsten macht? Dass ich mit meiner Wut fast alleine bin. Bis vor einiger Zeit hat mich das echt oft an den Rand der Verzweiflung gebracht. Alle sagen sie zu mir: Reg dich nicht auf, so ist es halt.«
»Wie die Schafe.«
»Wie die Schafe«, pflichtete ich ihm bei.
»Mensch, das ist doch alles zum Kotzen«, fasste er das Weltgeschehen aussagekräftig zusammen.
Er hatte zwar Recht mit seinen Ausführungen und seine Ablehnung der Zustände war moralisch durchaus lobenswert, doch allein mit moralischer Entrüstung war kein Blumentopf zu gewinnen.
»Und dennoch machst du mit«, stellte ich beiläufig fest.
»Wieso?«
»Na, dein Job…«
»Na ja, was soll man tun. Man muss ja irgendwie.«
»Nein. Wenn man konsequent ist, muss man das nicht.«
»Du hast gut reden. Du bist ja arbeitslos.«
Eines musste man dieser Spießerbande lassen, der Informationsfluss funktionierte perfekt. Mein Stigma des arbeitslosen Untermenschentums hatte sich bereits herumgesprochen. Ich konnte das ›nur‹, das nicht gesagt wurde, förmlich sehen, als wäre es mit Leuchtbuchstaben in die Luft gesetzt.
»Ganz recht«, entgegnete ich, »und wenn du Eier in der Hose hättest, dann würdest du deinen beschissenen Job genauso an den Nagel hängen.«
Aus mir sprach Wut, zu einem Teil aber auch persönliche Enttäuschung, weil er hinter seiner Fassade genauso stromlinienförmig war wie alle anderen. Wäre er Diogenes gewesen, ich hätte mit aller Wucht gegen seine alberne Tonne getreten.
»Wenn du alles so scheiße findest, warum machst du dann noch mit? Wenn einer dich beim Pokern verarscht, dann schmeißt du doch die Karten hin und gehst, oder nicht? Stattdessen machst du einen auf kritisch und reflektiert, bist aber auch nur eines von diesen Schafen, das sich nach Strich und Faden verarschen lässt. Du bist der größte von allen Blendern hier. Du bist ein Feigling und ein Heuchler, weil Kritik ohne persönliche Konsequenz nichts anderes als Heuchelei ist.«
»Ach ja? Und du bist ein Arschloch«, konterte er und verließ kurzerhand die Party.
Nach diesem anregenden Dialog fand ich niemanden mehr, der mit mir reden wollte, was mich nicht besonders traurig stimmte, weil ich mich nun mit Leib und Seele dem Buffet widmen konnte. Totes Tier war ein angenehmerer Gesprächspartner, hatte es vor seinem Tod doch immerhin ein Rückgrat besessen, was man vom Rest der Anwesenden nur sehr eingeschränkt behaupten konnte.
Das war das beste Klassentreffen meines Lebens und vermutlich auch das letzte. Sie würden sich hüten, mich noch einmal einzuladen. Alleine dafür hatte es sich schon gelohnt.
One of the most inspirational speeches in recorded history was given by a comedian by the name of Charlie Chaplin:
The Greatest Speech Ever Made auf YouTube

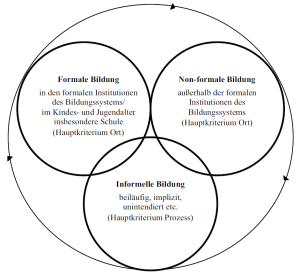
Neueste Kommentare