Sie war eine Weitsichtige: Was noch fern war oder schon wieder verabschiedet, das sah sie scharf. Was aber nah war, was sie unmittelbar umgab, das konnte sie nicht genau erkennen und hüllte es deshalb in Stereotype. Ihre Rhetorik war leidenschaftlich in der Erwartung und im Abschied, also bei den Dingen, die noch nicht sind, und bei jenen, die nicht mehr waren. Was tun mit uns? Zunächst reisten wir aufeinander zu, um die Nähe, die wir in der Ferne empfunden hatten, mit körperlicher Gegenwart zu beleben, aber allmählich wuchs der Verdacht, dass wir am Ende einen Platz leer finden würden. Ja, wir reisten voller Verlangen, doch verlegen, weil jetzt ein Körper saß, wo ein Phantom gewesen war. (…) Von außen waren wir ein Paar, von innen ein Arrangement.
(Roger Willemsen – Die Enden der Welt)
Die [gesellschaftlich] gleichermaßen erfahrbaren Formen struktureller und symbolischer Gewalt werden für die Deklassierten und Dequalifizierten umso leidvoller und entwaffnender, als sie unter den Vorzeichen und Verheißungen einer an individueller Selbstverwirklichung und ‑behauptung orientierten ‚Gesellschaft der Individuen‘ die Schuld für ihr Versagen zwangsläufig bei sich selbst suchen und dann wohl auch entdecken werden müssen. Symbolische Gewalt als die subtilste Form der Herrschaft beruht nun einmal auf einem Mechanismus, bei dem die Herrschaftsunterworfenen nicht umhin zu kommen scheinen, anzuerkennen, dass alles mit rechten Dingen zugeht und jeder nach den ihm gegebenen Möglichkeiten und Grenzen seines eigenen Glückes (oder Unglückes) Schmied ist.
(Franz Schultheis – Reproduktion in der Krise: Fallstudien zur symbolischen Gewalt; in: Barbara Friebertshäuser, Markus Rieger-Ladich & Lothar Wigger – Reflexive Erziehungswissenschaft)
Arbeit verhöhnt die Freiheit. Offiziell können wir uns glücklich schätzen, von Rechtsstaat und Demokratie umgeben zu sein. Andere arme Unglückliche, die nicht so frei sind wie wir, müssen in Polizeistaaten leben. Diese Opfer folgen Befehlen, egal wie willkürlich sie sind. Die Behörden halten sie unter dauernder Aufsicht. Staatsbeamte kontrollieren sogar kleinste Details ihres Alltagslebens. Die Bürokraten, die sie herumschubsen, müssen sich nur nach oben verantworten, in öffentlichen wie in Privat-Angelegenheiten. So und so werden Abweichung und Auflehnung bestraft. Regelmäßig leiten Informanten Berichte an die Behörden weiter. Das alles gilt als sehr schlecht.
Und das ist es auch, obwohl es nichts weiter darstellt als eine Beschreibung eines modernen Arbeitsplatzes. Die Liberalen und Konservativen und Freiheitlichen, die sich über Totalitarismus beschweren, sind Schwindler und Heuchler. (…) In einem Büro oder einer Fabrik herrscht dieselbe Art von Hierarchie und Disziplin wie in einem Kloster oder einem Gefängnis. Tatsächlich haben Foucault und andere gezeigt, daß Gefängnisse und Fabriken etwa zur gleichen Zeit aufkamen, und ihre Betreiber entliehen sich bewußt Kontrolltechniken voneinander. Ein Arbeiter ist ein Teilzeitsklave. Der Chef sagt, wann es losgeht, wann gegangen werden kann und was in der Zwischenzeit getan wird. Er schreibt vor, wieviel Arbeit zu erledigen ist und mit welchem Tempo. Es steht ihm frei, seine Kontrolle bis in demütigende Extreme auszuweiten, indem er festlegt (wenn ihm danach ist), welche Kleidung vorgeschrieben wird und wie oft die Toilette aufgesucht werden darf. Mit wenigen Ausnahmen kann er jeden aus jedem Grund feuern, oder auch ohne Grund. Er läßt bespitzeln und nachschnüffeln, er legt Akten über jeden Angestellten an. Widersprechen heißt „Unbotmäßigsein“, als wäre der Arbeiter ein ungezogenes Kind, und es sorgt nicht nur für sofortige Entlassung, es verringert auch die Chancen auf Arbeitslosenunterstützung. Ohne es unbedingt gutzuheißen, ist es wichtig anzumerken, daß Kinder zu Hause und in der Schule die gleiche Behandlung erfahren, bei ihnen durch die angenommene Unreife gerechtfertigt. Was sagt uns das über ihre Eltern und Lehrer, die arbeiten?
(Bob Black – Die Abschaffung der Arbeit; im Original: The Abolition of Work)
Unter einer Straßenlaterne steht ein Betrunkener und sucht und sucht. Ein Polizist kommt daher, fragt ihn, was er verloren habe, und der Mann antwortet: »Meinen Schlüssel«. Nun suchen beide. Schließlich will der Polizist wissen, ob der Mann sicher ist, den Schlüssel gerade hier verloren zu haben, und jener antwortet: »Nein, nicht hier, sondern dort hinten – aber dort ist es viel zu finster.«
Finden Sie das absurd? Wenn ja, suchen auch Sie am falschen Ort. Der Vorteil ist nämlich, daß eine solche Suche zu nichts führt, außer »mehr desselben«, nämlich nichts.
(…)
Die Bedeutung dieses Mechanismus für unser Thema liegt auf der Hand. Er kann ohne die Notwendigkeit einer Spezialausbildung auch vom Anfänger angewandt werden – ja, er ist so weit verbreitet, daß er seit den Tagen Freuds Generationen von Spezialisten ein gutes Ein- und Auskommen bietet; wobei allerdings zu bemerken ist, daß sie ihn nicht das Mehr-desselben-Rezept, sondern Neurose nennen.
Doch nicht auf den Namen soll es uns ankommen, sondern auf den Effekt. Dieser aber ist garantiert, solange der Unglücksaspirant sich an zwei einfache Regeln hält: Erstens, es gibt nur eine mögliche, erlaubte, vernünftige, sinnvolle, logische Lösung des Problems, und wenn diese Anstrengungen noch nicht zum Erfolg geführt haben, so beweist das nur, daß er sich noch nicht genügend angestrengt hat. Zweitens, die Annahme, daß es nur diese einzige Lösung gibt, darf selbst nie in Frage gestellt werden; herumprobieren darf man nur an der Anwendung dieser Grundannahme.
(Paul Watzlawick – Anleitung zum Unglücklichsein)
Wieder fahre ich mit einem Zug. Schon als Kind ist es mir die liebste Art des Reisens gewesen. Das Zugfahren übt auf mich eine Form von Magie aus, es fasziniert mich, es fesselt mich, es liefert meiner Phantasie einen Nährboden, auf dem sie prächtig gedeihen kann. Jedes Mal, seit ich klein war, habe ich mich auf das Zugfahren gefreut, schon Wochen, ja Monate im Voraus, wenn ich zufällig die Reiseplanung meiner Eltern aufgeschnappt hatte oder sie mir lächelnd davon erzählten, weil sie wussten, wie sehr ich der Bahnfahrt entgegenfiebern würde. Als ich sieben war, fuhren wir nach Frankreich, und ich löcherte meine Eltern tagelang mit einer Landkarte, wo wir denn langfahren würden und ob es dort Bäume gäbe oder Berge oder Tunnel oder Wiesen. Ich habe nie einschlafen können, wenn ich erfuhr, ich würde am nächsten Tag in einem Zug sitzen, so aufgeregt war ich, so voller Vorfreude. Es war ein Abenteuer, etwas Besonderes, etwas, wovon ich noch wochenlang schwärmen konnte.
Vielleicht war es albern, vielleicht auch bloß kindliche Faszination, aber ich habe mir bis heute ein wenig davon bewahrt. Ich war nie jemand, der in der Bahn die Zeitung liest oder sich ein Buch zur Hand nimmt. Dafür ist mir das Zugfahren schon immer viel zu aufregend gewesen. Ich interessierte mich nicht einmal besonders für die Mitmenschen um mich herum, die ihren Beschäftigungen nachgingen, im Gang standen, miteinander redeten oder versuchten zu schlafen. Stattdessen rannte ich vor meinen Eltern in den Wagen, suchte uns Plätze und setzte mich ans Fenster, nie irgendwo anders hin außer ans Fenster. Dann schaute ich hinaus. Die ganze Fahrt über saß ich da, jedes einzelne Mal, und blickte zufrieden durch das Glas auf die vorbeiziehende Welt, oder ich streckte, als ich schon etwas größer war, hin und wieder den Kopf durch das geöffnete Fenster, weil ich es genoss, den Fahrtwind auf der Haut zu spüren, dieses unmittelbare Gefühl der eigenen Fortbewegung.
Mit atemberaubender Geschwindigkeit raste ich an der Welt vorüber, an Menschen, Kindern vor allem, die staunend das Spektakel betrachteten, an Feldern, an Kühen und Bäumen, durch Bahnhöfe und an Straßen vorbei, und dennoch bewegt man sich die ganze Zeit im Grunde nur auf einem Pfad, den andere für einen vorgegeben haben. Ich ließ meine Gedanken schweifen, vergaß für eine Weile die Sorgen der Welt, schaute aus dem Zug und war einfach nur da, jetzt im Moment, vollkommen frei. Meine Phantasie verlor ihre gewohnte Zurückhaltung, sie wurde beflügelt von dem, was ich sehen, was ich hören und was ich spüren konnte. Das Rütteln des Wagens, der über die Gleise rauscht, das Getöse der Dampflokomotive und das rhythmische Geräusch der Achsen, das alles vermochte es bei jeder Fahrt aufs Neue, mich in eine Art Rausch zu versetzen, mich zu betören, zu umklammern und mich sanft in meine Tagträume zu schaukeln.
Ich stellte mir in solchen Momenten vor, ich wäre auf einem weitentfernten Planeten, der Entdecker fremder Sphären. Ich träumte von einer anderen Welt oder malte mir zuweilen aus, im Postwagen würden die wichtigsten Dokumente des Landes transportiert, geheimste Geheimsachen, Baupläne und Regierungsbeschlüsse, oder gar Schätze von unermesslichem Wert, und ich, ich wäre somit ein Teil des wichtigsten Zuges der Nation. Wenn ich an Wäldern vorbeifuhr, dann sah ich Bäume, die ihre Äste ineinander verschlungen hatten und tanzten, die herumwirbelten und dabei ihre Blätter ablegten wie Kleider, derer sie überdrüssig geworden sind. Ich stellte sie mir vor, wie sie gewöhnlich stolz dastehen, erhobenen Hauptes, sich weder Wind noch Regen beugen. Sie tragen ihre Kronen zu Recht, dachte ich dann, sie sind die wahren Könige, die Könige der Welt. Mit dem Zugfahren verbinde ich trotz all des Lärms die ruhigsten Momente meines Lebens, und obwohl man auf Schienen ständig unterwegs ist, war es ein Ort, an dem ich ankommen konnte, vor allem bei mir selbst. Wenn ich in einem Zug saß, dann fühlte ich mich glücklich.
Diesmal ist es anders. Der Wagen ist so voll, dass wir uns gegenseitig auf den Füßen stehen. Diesmal sitze ich nicht am Fenster, diesmal kann ich nicht nach draußen sehen, diesmal bin ich nicht glücklich. Dennoch stelle ich mir die Landschaft vor, die Felder und Bäume, wie sie allesamt an mir vorüberziehen oder vielmehr ich an ihnen, schnell und weitgehend unbemerkt. Die Bäume, sie winken mir zu, verbeugen sich vor mir im Wind, schauen mir nach, wünschen mir Glück. Wieder träume ich von einer anderen Welt, diesmal jedoch, weil mir der Glaube an diese hier abhandengekommen ist. Ich fürchte, es wird die letzte Zugfahrt meines Lebens sein, nach allem was man hört. Ich bin auf dem Weg zu einem Ort namens Treblinka.


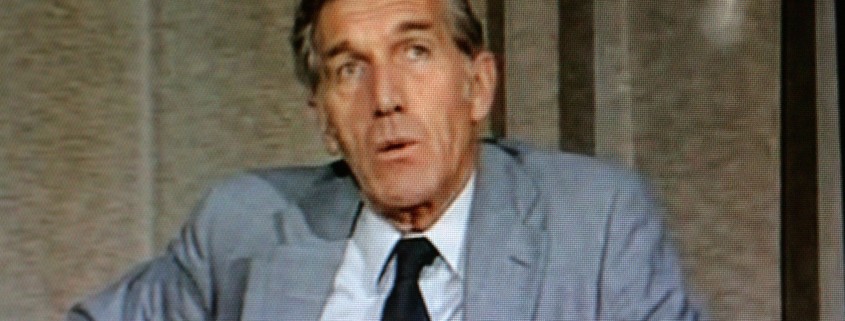

Neueste Kommentare