Vor etwas mehr als acht Monaten fand ich dank Twitter die tollste Frau der Welt. Alles begann mit zwei belanglosen Tweets, auf die der jeweils andere reagierte. Aus Replys wurden bald Direktnachrichten und schließlich der Gedanke an ein Treffen. Wir hatten bis dahin weder telefoniert noch anderweitig Kontakt gesucht als über Twitter.
Wir verabredeten uns für einen Nachmittag und ich blieb fast für eine Woche. Seit dem ersten Treffen sehen wir uns nun an jedem Wochenende, und das macht mich zum glücklichsten Menschen der Welt. Die auf Twitter oft verschriene Pärchenscheiße war nur eklig, bis sie kam, und sie ist der erste Mensch, bei dem ich nach längerem Rund-um-die-Uhr-Kontakt nicht das Bedürfnis habe, nun mal wieder für mich allein zu sein. Bei ihr bin ich zuhause, bei ihr bin ich ganz ich. Wir tun uns gegenseitig gut.
Seitdem benutzen wir Twitter gemeinsam, wenn man das so nennen mag. Wir zeigen uns gegenseitig Tweets aus der eigenen Timeline, wir starten gemeinsam Meme, wir hoffen auf Replys von nervigen Leuten, wir trollen unsere Follower mit ironisch gemeinten Tweets, wir lästern über andere, wir erstellen Videos und teilen sie, kurzum: wir haben Spaß. Twitter hilft, Gesprächspausen zu überbrücken, und Twitter dient auch als eine Art Rückzugsort, in den man kurz verschwinden kann, wenn hier draußen alles zu viel wird.
Aber das Medium, das uns zusammenbrachte, trennt uns auch immer wieder, wenngleich zum Glück nur temporär, für Augenblicke, Momente. Wir greifen hin und wieder zum Smartphone, wenn wir frühstücken, wenn wir einen Film schauen, wenn wir ausgehen, wenn wir im Café sitzen. Es ist ein kleines Timeout, so als würde einer von uns zur Tür rausgehen, kurz andere Leute treffen, und dann wieder reinkommen, als wäre nichts geschehen. Die Welt steht kurz still, der Raum wird gebrochen, einer fällt aus der Zeit.
Manchmal erhalten wir Nachrichten, Replys, DMs, E‑Mails, dann kommt jemand zur Tür herein, setzt sich frech zwischen uns ins Wohnzimmer oder an den Frühstückstisch, plaudert nur mit einem von uns, verdrängt den anderen aus der Welt, und verschwindet wieder so plötzlich, wie er aufgetreten ist.
Wir beäugen manchmal das Smartphone des jeweils anderen, wenn es ein Geräusch macht, wie einen Eindringling. Wir sind dann nicht wirklich allein, unter uns, zumindest kommt es mir zuweilen so vor. Da sind immer die Anderen, entweder passiv, indem sie einfach greifbar, lesbar, verfügbar sind, oder aktiv, indem sie mit einem von uns kommunizieren. Das ist auf seine Art schön, hin und wieder; als Dauerzustand verändert es jedoch die kostbare Zweisamkeit. Soziale Medien werden zum Eindringling, weil wir sie eindringen lassen, selbst in unsere Köpfe. Nicht selten denkt einer von uns oder wir beide bei einer Äußerung, einem Anblick, einer Kuriosität: „Das wäre ein schöner Tweet“. Wie ein Fotograf, der keine Landschaften und keine Menschen mehr sieht, nur noch potentielle Fotos. Man kann die Momente zwar laufend teilen, ruiniert sie dadurch aber auch.
Ich komme mir blöd vor, es zu erwähnen, weil es mir lächerlich erscheint, aber ich komme mir genauso vor, wenn ich es nicht tue, weil es mich doch stört.
Deine Schwächen gehören mir. Ich habe Dich unermüdlich beobachtet und sie nach und nach entdeckt. Ich leide darunter, daß Du sie hast, aber ich würde nicht wollen, daß Du Dich änderst. Ich erwähne sie Dir gegenüber manchmal mit einem Lächeln. Ich möchte Dich nicht kränken, Dir auch keine Ratschläge geben. Ich möchte, daß Du weißt, was ich weiß; und ich wünschte, statt zu versuchen, Dich anders zu geben, als Du bist, würdest Du mir all Deine kleinen Häßlichkeiten zeigen. Ich würde sie lieben, denn sie wären ganz mein. Die anderen würden sie nicht kennen, und dadurch wären wir außerhalb der Welt verbunden. Nichts ist liebenswerter als die Schwächen und Fehler: Durch sie dringt man zur Seele des geliebten Menschen vor, der Seele, die sich in dem Wunsch, wie alle anderen zu erscheinen, ständig verbirgt. Es ist wie bei einem Gesicht. Die anderen sehen nur ein Gesicht; doch man selbst weiß, an welcher Stelle genau die Kurve der Nase, statt ihre ideale Linie fortzusetzen, unmerklich bricht, um eine gewöhnliche Nase zu bilden; man weiß, daß die Poren der Haut aus der Nähe grob und schwarz sind; man hat den Fleck in den Augen gefunden, der mitunter den Blick erlöschen läßt, und den Millimeter zuviel, den die Lippe aufweist, um noch vornehm zu sein. Diese kleinen Makel möchte man lieber küssen als das Vollkommene, weil sie so arm sind und gerade sie es ausmachen, daß dieses Gesicht nicht das eines anderen ist.
Marcelle Sauvageot – Fast ganz die Deine
Die moderne Geschichte hat, denke ich, hinreichend bewiesen, dass jeder Mensch, oder fast jeder, unter gewissen Voraussetzungen das tut, was man ihm sagt; und, verzeiht mir, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass ihr die Ausnahme seid – so wenig wie ich. Wenn ihr in einem Land und in einer Zeit geboren seid, wo nicht nur niemand kommt, um eure Frau und eure Kinder zu töten, sondern auch niemand, um von euch zu verlangen, dass ihr die Frauen und Kinder anderer tötet, dann danket Gott und ziehet hin in Frieden. Aber bedenkt immer das eine: Ihr habt vielleicht mehr Glück gehabt als ich, doch ihr seid nicht besser. Denn solltet ihr so vermessen sein, euch dafür zu halten, seid ihr bereits in Gefahr. Gern stellen wir dem Staat – ob er totalitär ist oder nicht – den gewöhnlichen Menschen gegenüber, die Laus oder das kleine Licht. Dabei vergessen wir jedoch, dass der Staat aus Menschen besteht, mehr oder weniger gewöhnlichen Menschen, ein jeder mit seinem Leben, seiner Geschichte, jeder mit seiner Verkettung von Zufällen, die dafür gesorgt haben, dass er sich eines Tages auf der richtigen Seite des Gewehrs oder Dokuments wiederfindet, während andere auf der falschen stehen. Dieser Gang der Ereignisse ist in den seltensten Fällen das Ergebnis einer Entscheidung oder gar einer charakterlichen Veranlagung. Und die Opfer sind in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle nicht deshalb gefoltert oder getötet worden, weil sie gut waren, ebenso wenig wie ihre Peiniger sie aus Bosheit gequält haben. Das zu glauben wäre reichlich naiv; man braucht sich nur in einer beliebigen Bürokratie umzusehen, und sei es die des Roten Kreuzes, um sich davon zu überzeugen. (…) Die Maschinerie des Staates nun ist aus dem gleichen Sand gebacken wie das, was sie Korn für Korn zu Staub zermahlt. Es gibt sie, weil alle damit einverstanden sind, dass es sie gibt, sogar – und häufig bis zum letzten Atemzug – ihre Opfer. Ohne die Höß, Eichmanns, Goglidzes, Wyschinskis, aber auch ohne die Weichensteller, die Betonfabrikanten und die Buchhalter in den Ministerien wäre ein Stalin oder ein Hitler nur einer jener von Hass und ohnmächtigen Gewaltfantasien aufgeblähten Säcke gewesen.
Jonathan Littell – Die Wohlgesinnten
Man kann jahrelang in nervöser Hast in der Stadt leben, es ruiniert zwar die Nerven, aber man kann es lange Zeit durchhalten. Doch kein Mensch kann länger als ein paar Monate in nervöser Hast bergsteigen, Erdäpfel einlegen, holzhacken oder mähen. Das erste Jahr, in dem ich mich noch nicht angepaßt hatte, war weit über meine Kräfte gegangen, und ich werde mich von diesen Arbeitsexzessen nie ganz erholen. Unsinnigerweise hatte ich mir auf jeden derartigen Rekord auch noch etwas eingebildet. Heute gehe ich sogar vom Haus zum Stall in einem geruhsamen Wäldlertrab. Der Körper bleibt entspannt, und die Augen haben Zeit zu schauen. Einer, der rennt, kann nicht schauen. In meinem früheren Leben führte mich mein Weg jahrelang an einem Platz vorbei, auf dem eine alte Frau die Tauben fütterte. Ich mochte Tiere immer gern, und jenen, heute längst versteinerten Tauben gehörte mein ganzes Wohlwollen, und doch kann ich nicht eine von ihnen beschreiben. Ich weiß nicht einmal, welche Farbe ihre Augen und ihre Schnäbel hatten. Ich weiß es einfach nicht, und ich glaube, das sagt genug darüber aus, wie ich mich durch die Stadt zu bewegen pflegte. Seit ich langsamer geworden bin, ist der Wald um mich erst lebendig geworden. Ich möchte nicht sagen, daß dies die einzige Art zu leben ist, für mich ist sie aber gewiß die angemessene. Und was mußte alles geschehen, ehe ich zu ihr finden konnte. Früher war ich immer irgendwohin unterwegs, immer in großer Eile und erfüllt von einer rasenden Ungeduld, denn überall, wo ich anlangte, mußte ich erst einmal lange warten. Ich hätte ebensogut den ganzen Weg dahinschleichen können. Manchmal erkannte ich meinen Zustand und den Zustand unserer Welt ganz klar, aber ich war nicht fähig, aus diesem unguten Leben auszubrechen. Die Langeweile, unter der ich oft litt, war die Langeweile eines biederen Rosenzüchters auf einem Kongreß der Autofabrikanten. Fast mein ganzes Leben lang befand ich mich auf einem derartigen Kongreß, und es wundert mich, daß ich nicht eines Tages vor Überdruß tot umgefallen bin.
Hier, im Wald, bin ich eigentlich auf dem mir angemessenen Platz. Ich trage den Autofabrikanten nichts nach, sie sind ja längst nicht mehr interessant. Aber wie sie mich alle gequält haben mit Dingen, die mir zuwider waren. Ich hatte nur dieses eine kleine Leben, und sie ließen es mich nicht in Frieden leben.
Marlen Haushofer – Die Wand
Wir brechen in den Kosmos auf, wir sind auf alles vorbereitet, das heißt, auf die Einsamkeit, auf den Kampf, auf Martyrium und Tod. Aus Bescheidenheit sprechen wir es nicht laut aus, aber wir denken uns manchmal, daß wir großartig sind. Indessen, indessen ist das nicht alles, und unsere Bereitschaft erweist sich als Theater. Wir wollen gar nicht den Kosmos erobern, wir wollen nur die Erde bis an seine Grenzen erweitern. Die einen Planeten haben voll Wüste zu sein, wie die Sahara, die anderen eisig wie der Pol oder tropisch wie der brasilianische Urwald. Wir sind humanitär und edel, wir wollen die anderen Rassen nicht unterwerfen, wir wollen ihnen nur unsere Werte übermitteln und, als Gegengabe, ihrer aller Erbe annehmen. Wir halten uns für die Ritter vom heiligen Kontakt. Das ist die zweite Lüge. Menschen suchen wir, niemanden sonst. Wir brauchen keine anderen Welten. Wir brauchen Spiegel. Mit anderen Welten wissen wir nichts anzufangen. Es genügt unsere eine, und schon ersticken wir an ihr. Wir wollen das eigene idealisierte Bild finden; diese Globen, diese Zivilisationen haben vollkommener zu sein als die unsere, in anderen wiederum hoffen wir das Abbild unserer primitiven Vergangenheit zu finden. Indessen ist auf der anderen Seite etwas, was wir nicht akzeptieren, wogegen wir uns wehren, und schließlich haben wir von der Erde nicht nur das pure Destillat aus lauter Tugenden mitgebracht, das heroische Standbild des Menschen! Wir sind so hierhergeflogen, wie wir wirklich sind, und wenn die andere Seite uns diese Wahrheit zeigt, diesen Teil von ihr, den wir verschweigen, – dann können wir das nicht hinnehmen!
Stanislaw Lem – Solaris

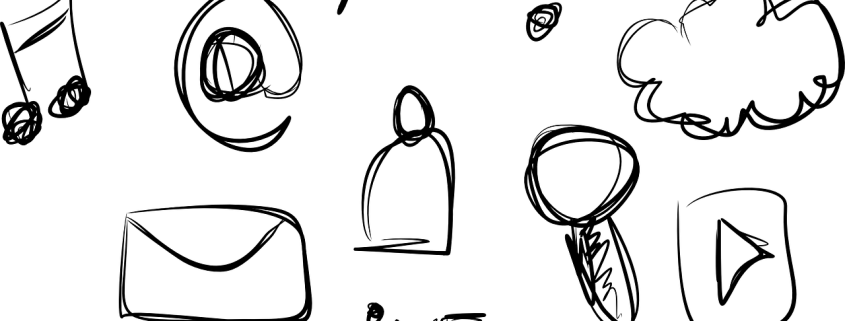

Neueste Kommentare