Gegenüber der imaginären Anthropologie der Wirtschaftswissenschaft, die sich noch nie der Formulierung universeller Gesetze der »zeitlichen Präferenz« entschlagen konnte, ist daran zu erinnern, daß die jeweilige Geneigtheit zur Unterordnung gegenwärtiger Wünsche unter zukünftige Befriedigungen davon abhängt, wie »vernünftig« dieses Opfer ist, d.h. von den jeweiligen Chancen, auf jeden Fall in der Zukunft mehr an Befriedigung zu erhalten als was gegenwärtig geopfert wurde. Unter die ökonomischen Bedingungen der Neigung, untermittelbare Wunscherfüllung zugunsten künftig erhoffter zurückzustellen, ist gleichermaßen die in der gegenwärtigen Lage angelegte Wahrscheinlichkeit der zukünftigen Befriedigung zu rechnen. (…) Für diejenigen, die – wie es so heißt – keine Zukunft haben, die jedenfalls von dieser wenig zu erwarten haben, stellt der Hedonismus, der Tag für Tag zu den unmittelbar gegebenen seltenen Befriedigungsmöglichkeiten (»die günstigen Augenblicke«) greifen läßt, allemal noch die einzig denkbare Philosophie dar. Verständlicher wird damit, warum der vornehmlich im Verhältnis zur Nahrung sich offenbarende praktische Materialismus zu einem der Grundbestandteile des Ethos, ja selbst der Ethik der unteren Klassen gehört: das Gegenwärtigsein im Gegenwärtigen, das sich bekundet in der Sorge, die günstigen Augenblicke auszunutzen und die Zeit zu nehmen, wie sie kommt, ist von sich aus Manifestation von Solidarität mit den anderen (die im übrigen häufig genug die einzige vorhandene Sicherheit gegen die Unbill der Zukunft bilden) insoweit, als in diesem gleichsam vollkommenen zeitlichen Immanenzverhalten sich doch auch die Anerkennung der die spezifische Lage definierenden Grenzen offenbart.
(Pierre Bourdieu – Die feinen Unterschiede)
In der Regionalbahn, eine wahre Begebenheit. Zwei ältere Herren betreten den Doppelstockwagen und suchen sich einen Sitzplatz im oberen Bereich:
#1: Das sind doch schöne Plätze. Ich mag es hier oben.
#2: Aber du weißt: Wenn man erst einmal oben ist …
#1: … will man nicht wieder runter?
#2: Das auch. Vor allem aber will man immer höher. Wie Schiller schon sagte: »Streben wir nicht allzu hoch hinauf, daß wir zu tief nicht fallen mögen«.
#1: Nun, das ist eben Risiko. Ich glaube, risikobewusste Menschen sitzen oben, anstatt unten in der Masse unterzugehen.
#2: Aber man braucht die da unten, um sich hier oben besser fühlen zu können.
PAUSE
#1: Ich mag die Aussicht hier oben. Man sieht so weit. Unten sieht man nur Büsche.
#2: Man sieht vielleicht mehr, aber sieht man auch besser?
#1: Ich denke schon. Man kann anderen besser helfen, wenn man oben ist. Man hat mehr Möglichkeiten und einen besseren Überblick.
#2: Da habe ich andere Erfahrungen: Oben sieht man über alles hinweg. Solange die von unten nicht nach oben kommen, nimmt man sie nicht wahr.
#1: Da hast du Recht. Aber es scheint, die haben sich mit ihrem Platz da unten abgefunden.
#2: Vielleicht weil sie noch nie oben waren.
#1: Das kann sein.
Fazit: So einfach kann man die Gesellschaft grob zusammenfassen. Während gestern noch vom so genannten Fahrstuhleffekt gesprochen wurde, kommt es nun durch Auflösung der Mittelschicht zur Doppelstockwagen-Gesellschaft.
You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.
Buckminster Fuller
Eines der wichtigsten Prinzipien, das man erlernen sollte, wenn man sich – ob als Soziologe oder ganz allgemein – mit gesellschaftlichen Phänomenen auseinandersetzt und dabei Argumenten, Statistiken, Erklärungen, Beschreibungen, Institutionen, Traditionen oder Handlungsweisen begegnet, die auf den ersten Blick plausibel und einleuchtend erscheinen, fasst folgende Aussage recht prägnant zusammen:
I’m trying to break you of the habit of automatically saying, „Yes, this makes sense. I’ll accept it.“ I’m trying to train you to pause and say, „Yes, this seems to make sense. But does it?“
(Daniel Quinn – If They Give You Lined Paper, Write Sideways)
Wir sind es gewohnt, ein derart skeptisches Verhalten an den Tag zu legen, wenn uns etwas ein wenig merkwürdig, zweifelhaft oder gar falsch vorkommt. Weitaus spannender, weil größeren Erkenntnisgewinn versprechend, ist es allerdings, dieses Verhalten auch und gerade bei denjenigen Phänomenen und Mechanismen anzuwenden, die uns auf den ersten Blick, aus Gewohnheit oder aufgrund des gesunden Menschenverstands als durchaus vernünftig erscheinen – weil sie es nämlich oft gar nicht sind, sondern bloß so erscheinen, da sie nie in Frage gestellt werden.
Die erste Handlung des Forschers ist, die Fragen des gesunden Menschenverstands (…) zu destruieren, sie völlig anders neu zu stellen.
(Pierre Bourdieu – Was anfangen mit der Soziologie?, in: Die verborgenen Mechanismen der Macht)
Von Zeit zu Zeit wirst du Fehler machen. Fehler sind unvermeidlich. Manchmal werden deine Fehler sogar riesig sein. Hauptsache ist, dass du aus ihnen lernst. Es ist keine Schande hinzufallen, vorausgesetzt man ist zwei Zentimeter größer geworden, wenn man sich wieder erhebt.
Jahre werden kommen, an denen du dich weit weg von Zuhause befindest. Du wirst dir vielleicht nicht mehr sicher sein, wo du hingehörst. Vergiss nicht: das Zuhause ist überall, es ist an keinen Ort gebunden. Du bist da zuhause, wo dich dein Gefühl hingeführt hat.
Im Laufe deines Lebens wirst du Freunde verlieren und neue gewinnen. Dieser Prozess ist schmerzhaft, aber häufig einfach notwendig. Der Kreis der Freunde ändert sich, du änderst dich, das Leben ändert sich. Irgendwann ist jeder gezwungen, einen eigenen neuen Weg zu finden, und dieser Weg ist vielleicht nicht deiner. Akzeptiere die Freunde so, wie sie sind, und behalte sie immer in guter Erinnerung.
Eins noch: Ich glaube daran… Besser: Ich bin fest davon überzeugt, dass sich die Dinge früher oder später immer zum Guten wenden werden. Es gibt schlimme Phasen im Leben. Wir leiden, wir verlieren das, was wir lieben. Der Lebensweg ist niemals leicht. Und das hat auch nie jemand behauptet, aber auf lange Sicht, wenn man dem, an das man glaubt, treu bleibt, endet alles gut.
(Babylon 5)

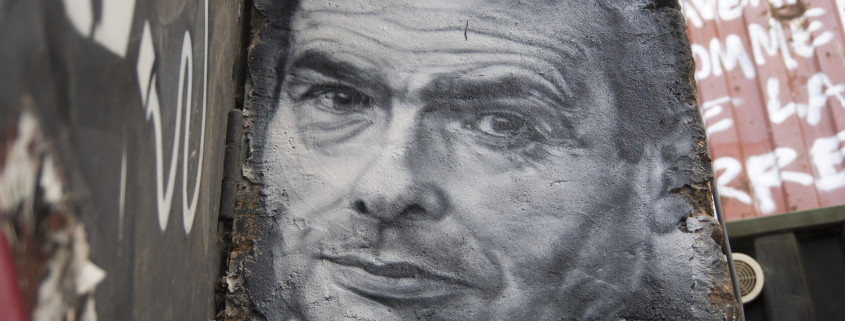
Neueste Kommentare